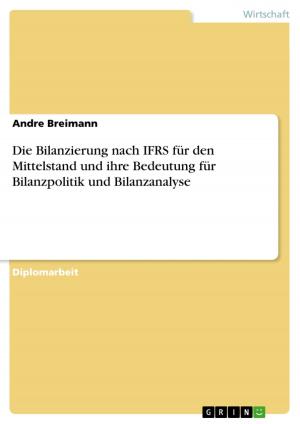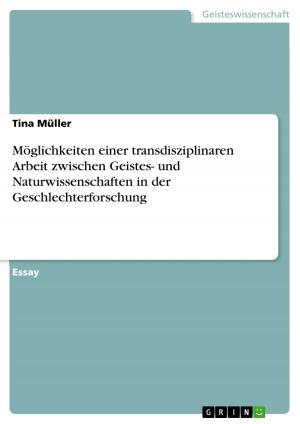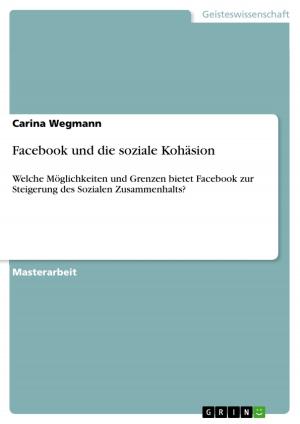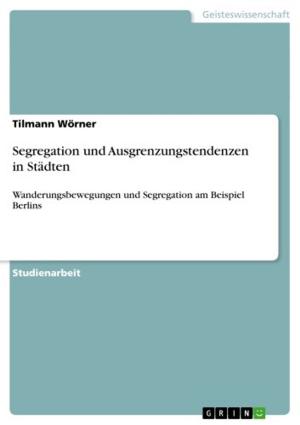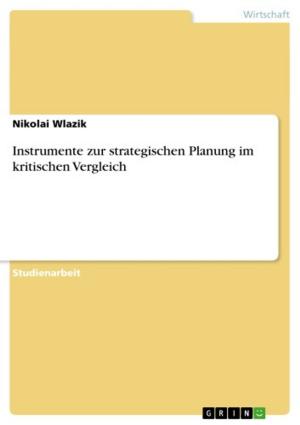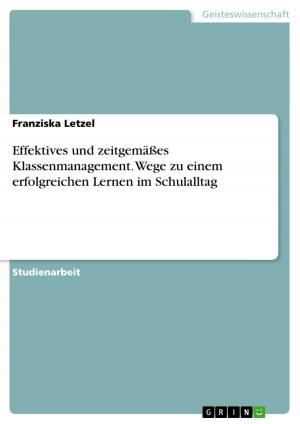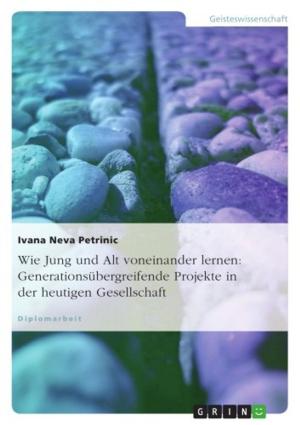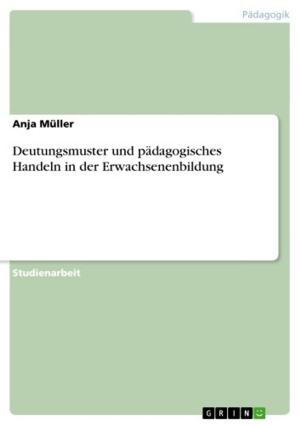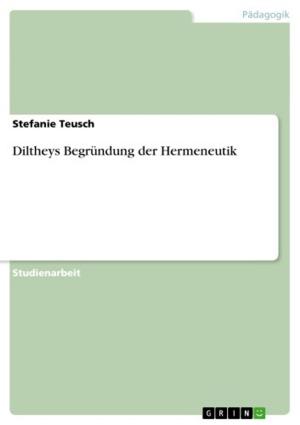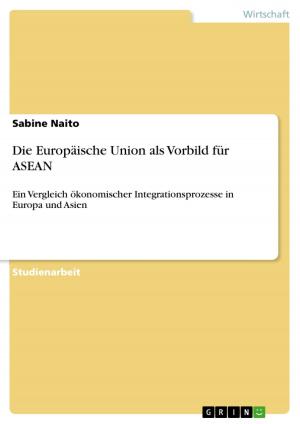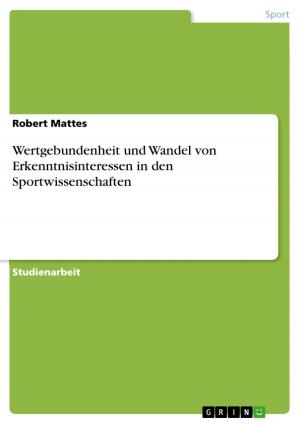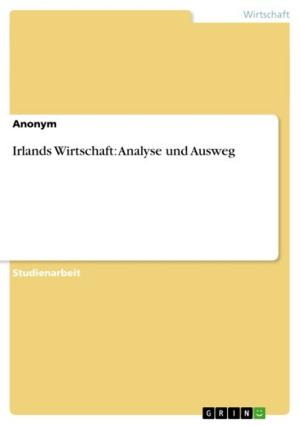Die hochschulische Anerkennung nicht-akademischer Kompetenzen in Deutschland
Wege zur Kompetenzerfassung und -bilanzierung anhand von Best-Practice-Modellen
Nonfiction, Reference & Language, Education & Teaching, Educational Theory, Adult & Continuing Education| Author: | Birgit Czanderle | ISBN: | 9783656613459 |
| Publisher: | GRIN Verlag | Publication: | March 12, 2014 |
| Imprint: | GRIN Verlag | Language: | German |
| Author: | Birgit Czanderle |
| ISBN: | 9783656613459 |
| Publisher: | GRIN Verlag |
| Publication: | March 12, 2014 |
| Imprint: | GRIN Verlag |
| Language: | German |
Masterarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Pädagogik - Erwachsenenbildung, Note: 1,0, Technische Universität Kaiserslautern (Erwachsenenbildung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Hochschullandschaft in Deutschland ist nicht nur durch die im Bologna-Prozess angestoßenen Reformen im Umbruch. Auch seitens der Zusammensetzung der Studierenden ist ein erhebliches Veränderungspotenzial zu erkennen. Und damit sind lediglich zwei Veränderungsprozesse in der deutschen Hochschullandschaft genannt. Die Studierendengruppe wird zunehmend heterogener und auch die Kompetenzen, die die Studierenden mit in einen Studiengang bringen, lassen sich nicht mehr klar differenzieren. Die Tendenz, dass eine Berufs- und Bildungsbiographie im Laufe eines lebenslangen Lernens im akademischen Sektor mündet, wird zunehmend größer. Diese Durchlässigkeit ist wünschens- und erstrebenswert, markiert jedoch auch einen Paradigmenwechsel in der deutschen Bildungslandschaft. Im Rahmen dieses Paradigmas ist unweigerlich anzuerkennen, dass unterschiedliche Lernorte zu vergleichbaren Lernergebnissen führen können und dass unterschiedliche Bildungswege anschlussfähig gemacht werden müssen. Aufgrund dieser Tendenzen stellen sich auch in der Studiengangsgestaltung neue Herausforderungen ebenso wie auf bildungspolitischer Ebene. Wie soll mit den Kompetenzen dieser genannten neuen Studierendengruppe umgegangen werden? Diese mit Nichtbeachtung zu versehen, wäre weder effizient noch gesellschaftlich durchsetzbar. So stehen die Hochschulen also vor der Herausforderung, einen transparenten und qualitätsgesicherten Weg zu finden, wie mit bereits erworbenen nicht-akademischen Kompetenzen innerhalb eines Studiums umgegangen werden kann. Doch was ist unter Kompetenzen überhaupt zu verstehen? Und inwiefern werden die Hochschulen bei Ihrer Aufgabe bildungspolitisch unterstützt? Der Anspruch dieser Studierendengruppe lässt sich aus den europäischen Bildungsreformen ableiten. Dies wirft die Frage auf, wie damit auf nationaler Ebene umgegangen wird und welche gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen wurden. Rechtliche Rahmen jedoch alleine genügen kaum, um eine operative Durchführbarkeit in die Wege zu leiten. Aus dieser Fragestellung heraus sind bildungspolitische Initiativen zu nennen, die hierzu mögliche Instrumentarien entwickelt haben. Auf der Basis dieser Entwicklungen gab es auf Bundesebene geförderte Projekte, die sich mit der Operationalisierbarkeit im Rahmen von Modellentwicklungen auseinander gesetzt bzw. Entwicklungen angestoßen haben. Diese sollen evaluiert werden und eine gemeinsame Wissensbasis geschaffen werden.
Masterarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Pädagogik - Erwachsenenbildung, Note: 1,0, Technische Universität Kaiserslautern (Erwachsenenbildung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Hochschullandschaft in Deutschland ist nicht nur durch die im Bologna-Prozess angestoßenen Reformen im Umbruch. Auch seitens der Zusammensetzung der Studierenden ist ein erhebliches Veränderungspotenzial zu erkennen. Und damit sind lediglich zwei Veränderungsprozesse in der deutschen Hochschullandschaft genannt. Die Studierendengruppe wird zunehmend heterogener und auch die Kompetenzen, die die Studierenden mit in einen Studiengang bringen, lassen sich nicht mehr klar differenzieren. Die Tendenz, dass eine Berufs- und Bildungsbiographie im Laufe eines lebenslangen Lernens im akademischen Sektor mündet, wird zunehmend größer. Diese Durchlässigkeit ist wünschens- und erstrebenswert, markiert jedoch auch einen Paradigmenwechsel in der deutschen Bildungslandschaft. Im Rahmen dieses Paradigmas ist unweigerlich anzuerkennen, dass unterschiedliche Lernorte zu vergleichbaren Lernergebnissen führen können und dass unterschiedliche Bildungswege anschlussfähig gemacht werden müssen. Aufgrund dieser Tendenzen stellen sich auch in der Studiengangsgestaltung neue Herausforderungen ebenso wie auf bildungspolitischer Ebene. Wie soll mit den Kompetenzen dieser genannten neuen Studierendengruppe umgegangen werden? Diese mit Nichtbeachtung zu versehen, wäre weder effizient noch gesellschaftlich durchsetzbar. So stehen die Hochschulen also vor der Herausforderung, einen transparenten und qualitätsgesicherten Weg zu finden, wie mit bereits erworbenen nicht-akademischen Kompetenzen innerhalb eines Studiums umgegangen werden kann. Doch was ist unter Kompetenzen überhaupt zu verstehen? Und inwiefern werden die Hochschulen bei Ihrer Aufgabe bildungspolitisch unterstützt? Der Anspruch dieser Studierendengruppe lässt sich aus den europäischen Bildungsreformen ableiten. Dies wirft die Frage auf, wie damit auf nationaler Ebene umgegangen wird und welche gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen wurden. Rechtliche Rahmen jedoch alleine genügen kaum, um eine operative Durchführbarkeit in die Wege zu leiten. Aus dieser Fragestellung heraus sind bildungspolitische Initiativen zu nennen, die hierzu mögliche Instrumentarien entwickelt haben. Auf der Basis dieser Entwicklungen gab es auf Bundesebene geförderte Projekte, die sich mit der Operationalisierbarkeit im Rahmen von Modellentwicklungen auseinander gesetzt bzw. Entwicklungen angestoßen haben. Diese sollen evaluiert werden und eine gemeinsame Wissensbasis geschaffen werden.