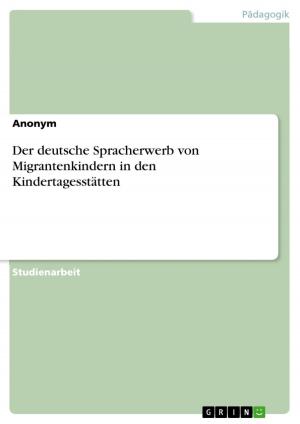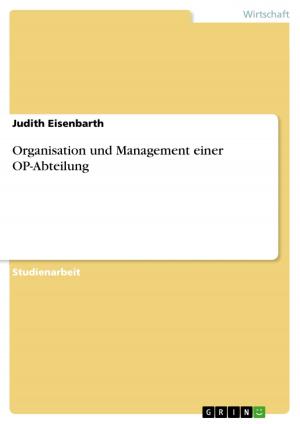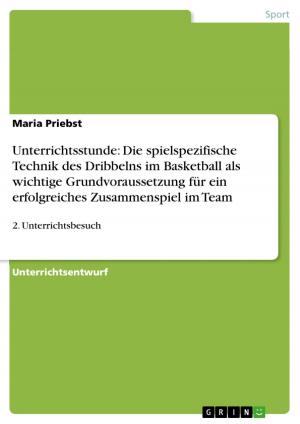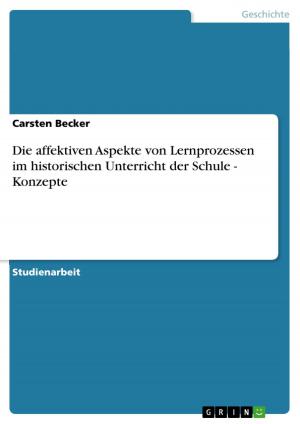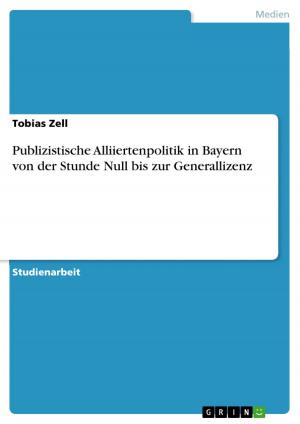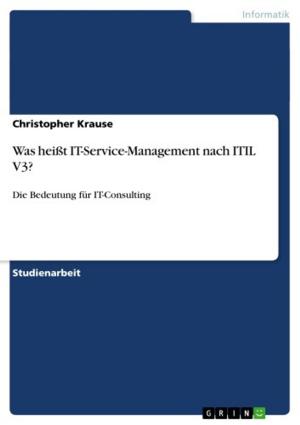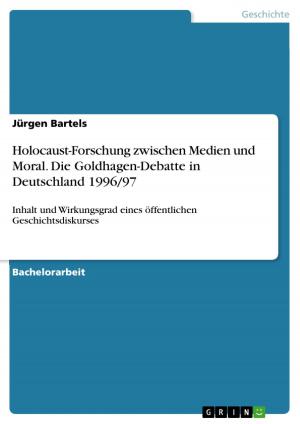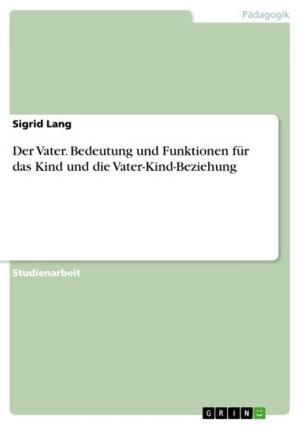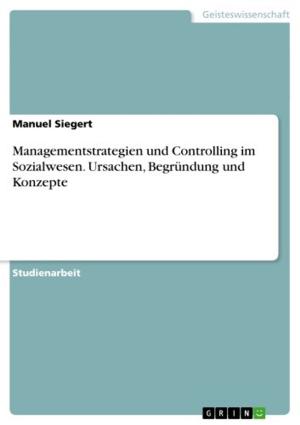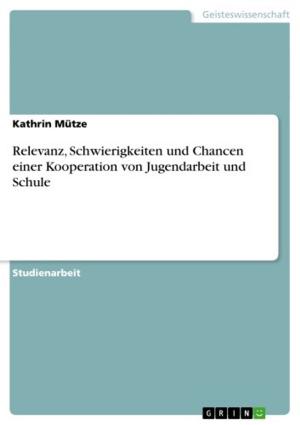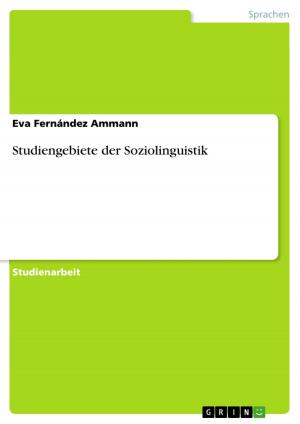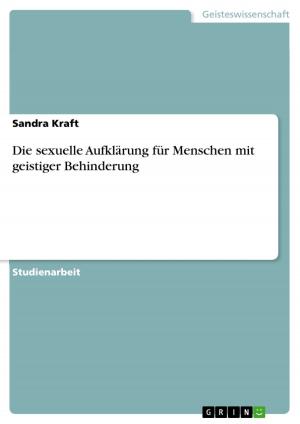Braucht Deutschland ein Gesetz zum Schutz der deutschen Sprache?
Nonfiction, Reference & Language, Law, International| Author: | Gerald G. Sander | ISBN: | 9783638489058 |
| Publisher: | GRIN Verlag | Publication: | April 11, 2006 |
| Imprint: | GRIN Verlag | Language: | German |
| Author: | Gerald G. Sander |
| ISBN: | 9783638489058 |
| Publisher: | GRIN Verlag |
| Publication: | April 11, 2006 |
| Imprint: | GRIN Verlag |
| Language: | German |
Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Jura - Andere Rechtssysteme, Rechtsvergleichung, Universität Hohenheim (Institut für Rechtswissenschaft), 8 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Angesichts der zunehmenden Unterwanderung der deutschen Sprache mit Anglizismen formiert sich in Teilen der Bevölkerung immer stärker der Widerstand gegen diese scheinbar unaufhaltsame Entwicklung. Nirgends lässt sich wohl besser als in Deutschland der Statussymbol-Charakter des Englischen in Wissenschaft, Ökonomie, Politik und im Alltag der Gesellschaft beobachten. Die Sprecher wollen sich weltgewandt, gebildet und modern geben; oftmals steckt jedoch nur schlichte Angeberei dahinter. Anglizismen und Amerikanismen wie Team, Couch, Game, Roadmap, Service, Competition, Public Relations, Redesign, Download, Knowledge, Level, Event, Meeting, Background, Backstage etc. bereichern in rasant steigender Zahl die deutsche Sprache. Allein das englische Wort Ticket ersetzt heutzutage u. a. die Eintrittskarte, den Fahrschein, den Parkschein, die Opernkarte und den Strafzettel. 'Mischmasch'-Wortschöpfungen wie Themen-Specials, Antriebspower, Hands-on-Mentalität, Telefon-Kampaigning, Themen-Setting, Stand-up-Kabarett und das Care-Telefon der AOK beherrschen immer mehr unser tägliches Leben. Insbesondere von älteren Personen werden diese Begriffe häufig gar nicht mehr verstanden. Auffallend ist auch der inflationäre, zum Teil aus dem Englischen übernommene Gebrauch des 'Apostroph-S'. Das im Volksmund auch 'Deppenapostroph' genannte Zeichen findet mittlerweile sowohl Anwendung bei der eigentlich fugenlosen Anhängung eines Artikels als auch bei der Abtrennung des Genitiv-S und inzwischen sogar - als Scheinanglizismus - bei der Pluralbildung5. In Nachahmung von 'McDonald's' kommt heute kaum noch ein deutsches Gewerbe ohne die Verwendung des apostrophierten S aus, wenn es um die Namenswahl geht (z. B. 'Erika's Hafenkneipe').
Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Jura - Andere Rechtssysteme, Rechtsvergleichung, Universität Hohenheim (Institut für Rechtswissenschaft), 8 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Angesichts der zunehmenden Unterwanderung der deutschen Sprache mit Anglizismen formiert sich in Teilen der Bevölkerung immer stärker der Widerstand gegen diese scheinbar unaufhaltsame Entwicklung. Nirgends lässt sich wohl besser als in Deutschland der Statussymbol-Charakter des Englischen in Wissenschaft, Ökonomie, Politik und im Alltag der Gesellschaft beobachten. Die Sprecher wollen sich weltgewandt, gebildet und modern geben; oftmals steckt jedoch nur schlichte Angeberei dahinter. Anglizismen und Amerikanismen wie Team, Couch, Game, Roadmap, Service, Competition, Public Relations, Redesign, Download, Knowledge, Level, Event, Meeting, Background, Backstage etc. bereichern in rasant steigender Zahl die deutsche Sprache. Allein das englische Wort Ticket ersetzt heutzutage u. a. die Eintrittskarte, den Fahrschein, den Parkschein, die Opernkarte und den Strafzettel. 'Mischmasch'-Wortschöpfungen wie Themen-Specials, Antriebspower, Hands-on-Mentalität, Telefon-Kampaigning, Themen-Setting, Stand-up-Kabarett und das Care-Telefon der AOK beherrschen immer mehr unser tägliches Leben. Insbesondere von älteren Personen werden diese Begriffe häufig gar nicht mehr verstanden. Auffallend ist auch der inflationäre, zum Teil aus dem Englischen übernommene Gebrauch des 'Apostroph-S'. Das im Volksmund auch 'Deppenapostroph' genannte Zeichen findet mittlerweile sowohl Anwendung bei der eigentlich fugenlosen Anhängung eines Artikels als auch bei der Abtrennung des Genitiv-S und inzwischen sogar - als Scheinanglizismus - bei der Pluralbildung5. In Nachahmung von 'McDonald's' kommt heute kaum noch ein deutsches Gewerbe ohne die Verwendung des apostrophierten S aus, wenn es um die Namenswahl geht (z. B. 'Erika's Hafenkneipe').