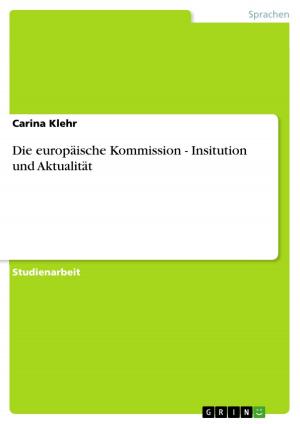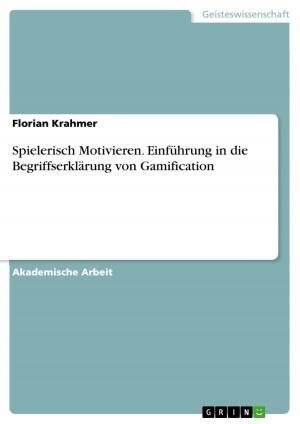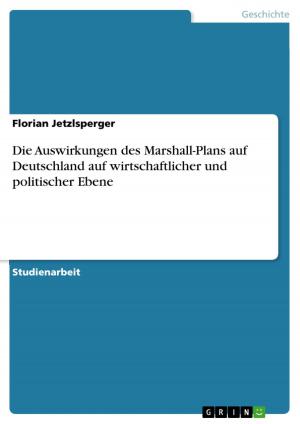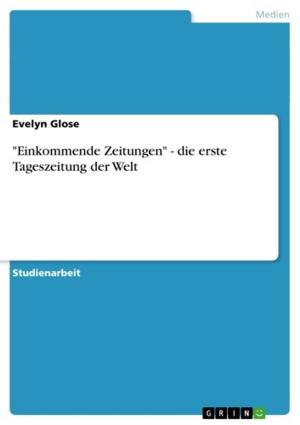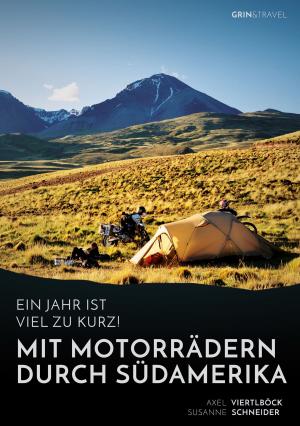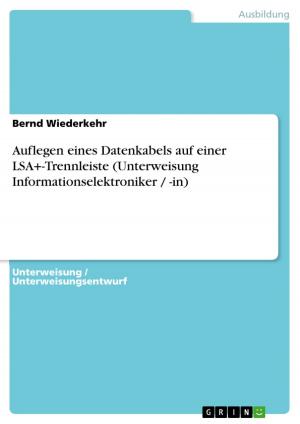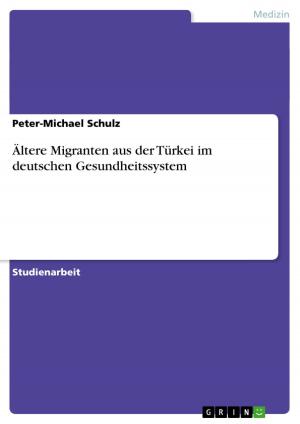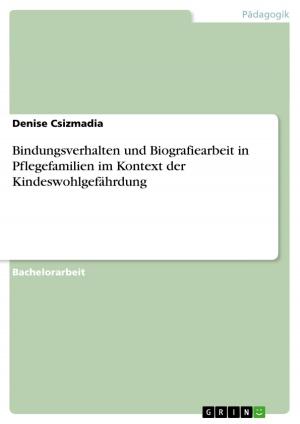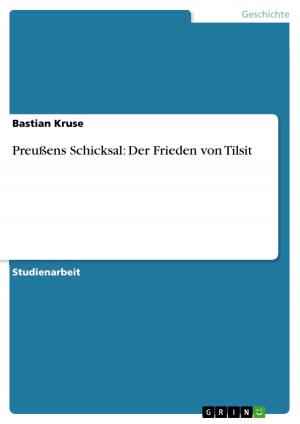Entscheidung und Begründung: Warum und mit welchem Ziel sollen gerichtliche Entscheidungen begründet werden? Gibt es einen Unterschied zwischen Begründung und Argumentation?
Nonfiction, Reference & Language, Law, Legal History| Author: | Dennis Kautz | ISBN: | 9783640401697 |
| Publisher: | GRIN Verlag | Publication: | August 17, 2009 |
| Imprint: | GRIN Verlag | Language: | German |
| Author: | Dennis Kautz |
| ISBN: | 9783640401697 |
| Publisher: | GRIN Verlag |
| Publication: | August 17, 2009 |
| Imprint: | GRIN Verlag |
| Language: | German |
Forschungsarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Jura - Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte, Note: 14 Punkte, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Begründungspflicht richterlicher Entscheidungen erscheint im historischen Vergleich keineswegs selbstverständlich. So wurde eine Entscheidungsbegründung zwar zumindest nicht durch das römisch-kanonische Recht untersagt - ihre tatsächliche Anwendung stellte jedoch die Ausnahme dar. Ihr Einzug in die europäische Rechtstradition lässt sich vielmehr erst in bzw. als Folge der Französischen Revolution 1789 feststellen - er erscheint insofern als Konsequenz des allmählichen rechtsstaatlichen Wandels mit Ende des 18. Jahrhunderts bzw. im 19. Jahrhundert. Die Begründung gerichtlicher Entscheidungen fällt somit zusammen mit einem bedeutenden Wandel in dem Verhältnis zwischen Staat und Bürger, Autorität und Adressaten, Richter und Betroffenem. Sie ist auch Ausdruck eines gewandelten Souveränitätsverständnisses. Die aktuelle Bewertung der Frage nach der Begründungspflicht richterlicher Entscheidungen und ihrer Wirkung ist abhängig von den gegebenen Bedingungen des demokratischen Staates. Dieser stellt die Lösung von Konflikten auf die Grundlage gemeinsamer Wertvorstellungen, welche sich in ständigen Institutionen manifestieren. Die Legitimität der Normsetzung ist in einer demokratischen Gesellschaft das Ergebnis eines gleichberechtigten Diskurses der Betroffenen. Beherrschendes Element jedes Diskurses ist die Entscheidung, welche an seinem Ende steht - dies gilt um so mehr, je weitreichender die Folgen dieser Entscheidung sich darstellen. Ein Beispiel von Entscheidungen mit besonders weitreichenden Folgen zeigt sich in der Rechtsprechung als öffentlichstem Element des juristischen Diskurses. Ihre Folgen reichen bis hin zu weitreichenden Konsequenzen in Form von Eingriffen in fundamentale Grundrechte. Im Falle von Rechtsstreitigkeiten über derartige Eingriffe zu befinden, ist originäre Aufgabe der Rechtsprechung. Um so wichtiger erscheint es, die zu treffenden Entscheidungen möglichst fehler- und widerspruchsfrei zu gestalten, kurz: den rechtsstaatlichen Erfordernissen des formellen Rechts und der Gerechtigkeit zu entsprechen. Aufgrund der prinzipiellen Fehlbarkeit menschlichen Handelns und Entscheidens (Luhmann - hierauf wird im Folgenden noch näher eingegangen werden - spricht diesbezüglich von dem Paradox der Entscheidung) wird der juristische, speziell der gerichtliche Diskurs strengen formellen Regelungen unterworfen, um rechtsstaatlichen Erfordernissen zu entsprechen und ein faires Verfahren zu garantieren.
Forschungsarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Jura - Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte, Note: 14 Punkte, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Begründungspflicht richterlicher Entscheidungen erscheint im historischen Vergleich keineswegs selbstverständlich. So wurde eine Entscheidungsbegründung zwar zumindest nicht durch das römisch-kanonische Recht untersagt - ihre tatsächliche Anwendung stellte jedoch die Ausnahme dar. Ihr Einzug in die europäische Rechtstradition lässt sich vielmehr erst in bzw. als Folge der Französischen Revolution 1789 feststellen - er erscheint insofern als Konsequenz des allmählichen rechtsstaatlichen Wandels mit Ende des 18. Jahrhunderts bzw. im 19. Jahrhundert. Die Begründung gerichtlicher Entscheidungen fällt somit zusammen mit einem bedeutenden Wandel in dem Verhältnis zwischen Staat und Bürger, Autorität und Adressaten, Richter und Betroffenem. Sie ist auch Ausdruck eines gewandelten Souveränitätsverständnisses. Die aktuelle Bewertung der Frage nach der Begründungspflicht richterlicher Entscheidungen und ihrer Wirkung ist abhängig von den gegebenen Bedingungen des demokratischen Staates. Dieser stellt die Lösung von Konflikten auf die Grundlage gemeinsamer Wertvorstellungen, welche sich in ständigen Institutionen manifestieren. Die Legitimität der Normsetzung ist in einer demokratischen Gesellschaft das Ergebnis eines gleichberechtigten Diskurses der Betroffenen. Beherrschendes Element jedes Diskurses ist die Entscheidung, welche an seinem Ende steht - dies gilt um so mehr, je weitreichender die Folgen dieser Entscheidung sich darstellen. Ein Beispiel von Entscheidungen mit besonders weitreichenden Folgen zeigt sich in der Rechtsprechung als öffentlichstem Element des juristischen Diskurses. Ihre Folgen reichen bis hin zu weitreichenden Konsequenzen in Form von Eingriffen in fundamentale Grundrechte. Im Falle von Rechtsstreitigkeiten über derartige Eingriffe zu befinden, ist originäre Aufgabe der Rechtsprechung. Um so wichtiger erscheint es, die zu treffenden Entscheidungen möglichst fehler- und widerspruchsfrei zu gestalten, kurz: den rechtsstaatlichen Erfordernissen des formellen Rechts und der Gerechtigkeit zu entsprechen. Aufgrund der prinzipiellen Fehlbarkeit menschlichen Handelns und Entscheidens (Luhmann - hierauf wird im Folgenden noch näher eingegangen werden - spricht diesbezüglich von dem Paradox der Entscheidung) wird der juristische, speziell der gerichtliche Diskurs strengen formellen Regelungen unterworfen, um rechtsstaatlichen Erfordernissen zu entsprechen und ein faires Verfahren zu garantieren.