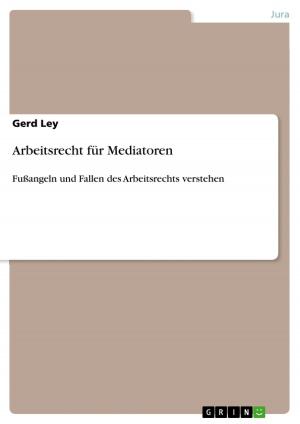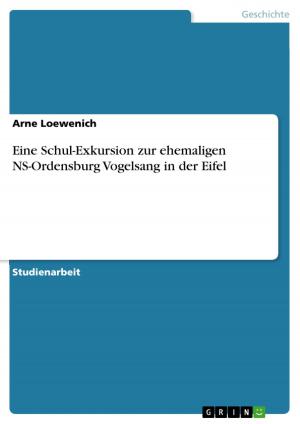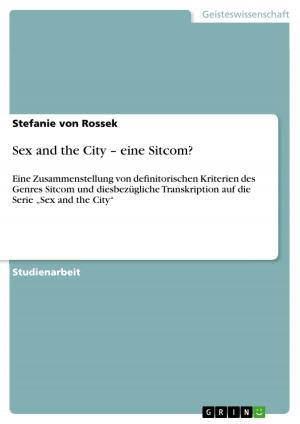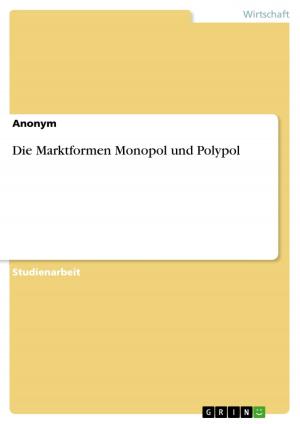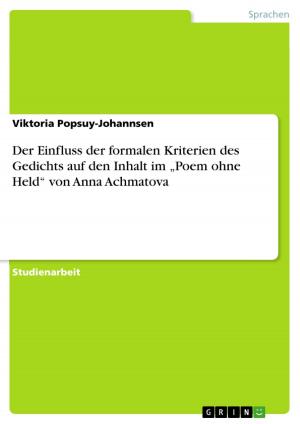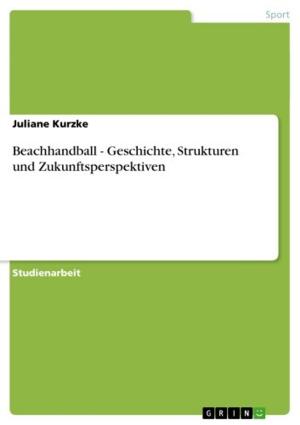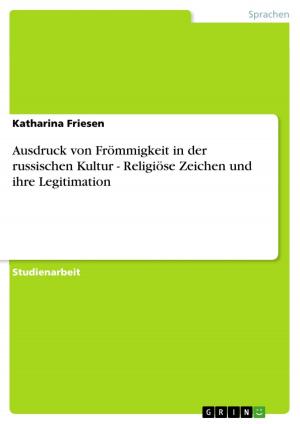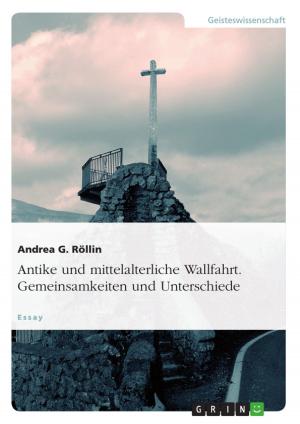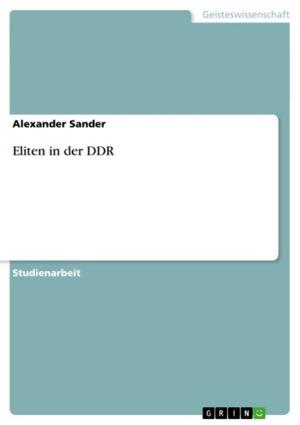Die Frauenquote in Deutschland
Eine sinnvolle Maßnahme zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen?
Nonfiction, Social & Cultural Studies, Social Science, Sociology| Author: | Britta Küthen | ISBN: | 9783656495048 |
| Publisher: | GRIN Verlag | Publication: | September 11, 2013 |
| Imprint: | GRIN Verlag | Language: | German |
| Author: | Britta Küthen |
| ISBN: | 9783656495048 |
| Publisher: | GRIN Verlag |
| Publication: | September 11, 2013 |
| Imprint: | GRIN Verlag |
| Language: | German |
Examensarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Soziologie - Familie, Frauen, Männer, Sexualität, Geschlechter, Note: 1,3, Universität Duisburg-Essen (Institut für Soziologie), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Geschichte der Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland ist eng mit der Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit verknüpft. Die Unterscheidung in ein weibliches und ein männliches Geschlecht sowie die Zuschreibung damit einhergehender charakterlicher Eigenschaften und Fähigkeiten sind die Grundlage für eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts vollzieht sich im Deutschen Reich ein Wandel vom 'ganzen Haus', also einer 'sozialen Einheit von Produktions- und Familienleben' im bäuerlichen und handwerklichen Bereich, hin zur bürgerlichen Kleinfamilie. Dieser Wandel begründete sich in der zunehmenden Ausbreitung der kapitalistischen Arbeitsweise im Rahmen der Industrialisierung und der damit einhergehenden Trennung von Arbeits- und Wohnstätte (vgl. ebd.: 18). Im Zuge dieses Wandels entsteht zunächst im wohlhabenden und gebildeten Bürgertum das Idealbild, dass Frauen sich ganz der Hausarbeit und der Kindererziehung zu widmen haben, während der Mann die Rolle des Ernährers und des Familienoberhauptes inne hat (vgl. Rinken 2010: 64; vgl. Peuckert 2008: 18ff.). Das bürgerliche Modell des männlichen Familienernährers wird zwar Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zunehmend auch in Arbeiterschichten populär, eine schichtübergreifende Etablierung und Durchsetzung dieses Familientyps bleibt jedoch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts aus (vgl. Gildemeister/Hericks 2012: 48). Die Mehrheit der Bevölkerung kann aufgrund der schwachen sozio-ökonomischen Lage (niedrige Löhne, hohe Arbeitslosigkeit) nicht auf das Einkommen der Frauen verzichten (vgl. Peuckert 2008: 19, Klenner et al. 2012: 25). [...]
Examensarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Soziologie - Familie, Frauen, Männer, Sexualität, Geschlechter, Note: 1,3, Universität Duisburg-Essen (Institut für Soziologie), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Geschichte der Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland ist eng mit der Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit verknüpft. Die Unterscheidung in ein weibliches und ein männliches Geschlecht sowie die Zuschreibung damit einhergehender charakterlicher Eigenschaften und Fähigkeiten sind die Grundlage für eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts vollzieht sich im Deutschen Reich ein Wandel vom 'ganzen Haus', also einer 'sozialen Einheit von Produktions- und Familienleben' im bäuerlichen und handwerklichen Bereich, hin zur bürgerlichen Kleinfamilie. Dieser Wandel begründete sich in der zunehmenden Ausbreitung der kapitalistischen Arbeitsweise im Rahmen der Industrialisierung und der damit einhergehenden Trennung von Arbeits- und Wohnstätte (vgl. ebd.: 18). Im Zuge dieses Wandels entsteht zunächst im wohlhabenden und gebildeten Bürgertum das Idealbild, dass Frauen sich ganz der Hausarbeit und der Kindererziehung zu widmen haben, während der Mann die Rolle des Ernährers und des Familienoberhauptes inne hat (vgl. Rinken 2010: 64; vgl. Peuckert 2008: 18ff.). Das bürgerliche Modell des männlichen Familienernährers wird zwar Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zunehmend auch in Arbeiterschichten populär, eine schichtübergreifende Etablierung und Durchsetzung dieses Familientyps bleibt jedoch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts aus (vgl. Gildemeister/Hericks 2012: 48). Die Mehrheit der Bevölkerung kann aufgrund der schwachen sozio-ökonomischen Lage (niedrige Löhne, hohe Arbeitslosigkeit) nicht auf das Einkommen der Frauen verzichten (vgl. Peuckert 2008: 19, Klenner et al. 2012: 25). [...]