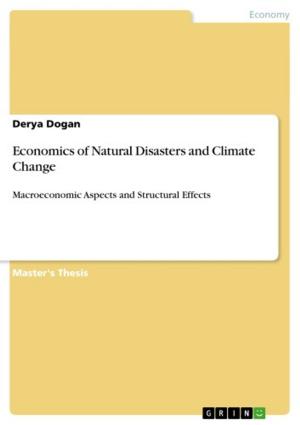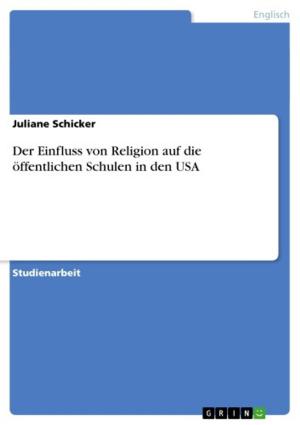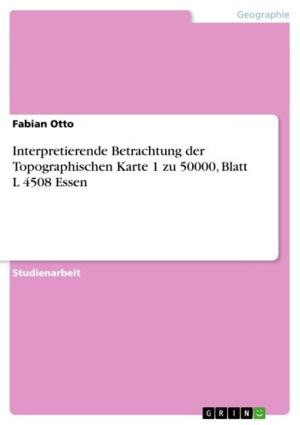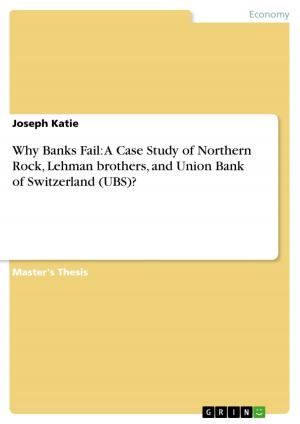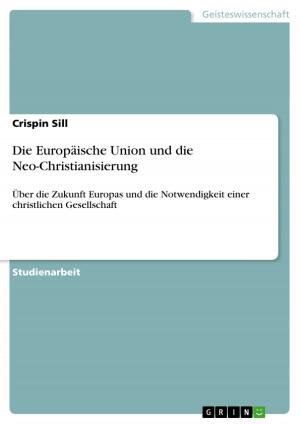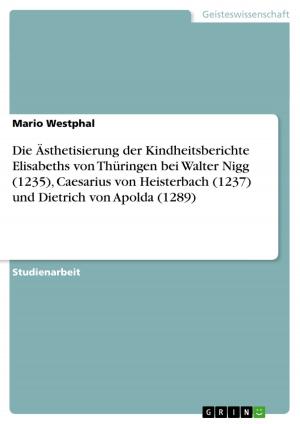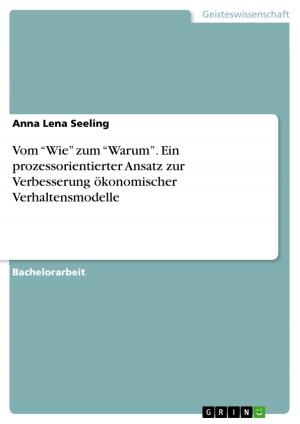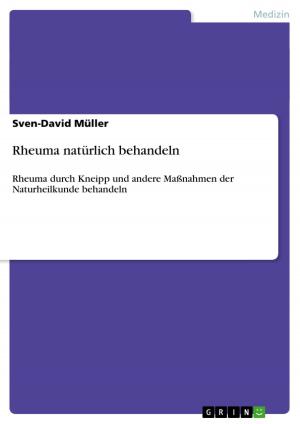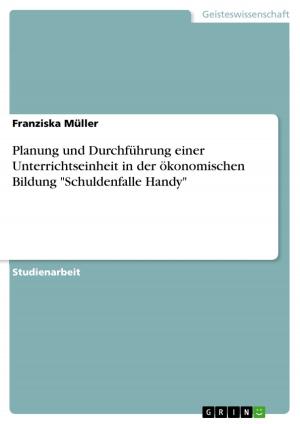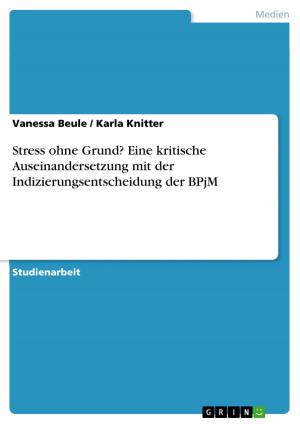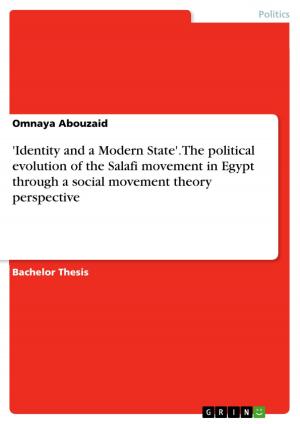Zur geschichtlichen Legitimation des Sportunterrichts am Beispiel der philanthropischen Gymnastik
Nonfiction, Sports| Author: | Christian Klaas | ISBN: | 9783638884471 |
| Publisher: | GRIN Verlag | Publication: | January 2, 2008 |
| Imprint: | GRIN Verlag | Language: | German |
| Author: | Christian Klaas |
| ISBN: | 9783638884471 |
| Publisher: | GRIN Verlag |
| Publication: | January 2, 2008 |
| Imprint: | GRIN Verlag |
| Language: | German |
Examensarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Sport - Sportpädagogik, Didaktik, Note: 1,0, Technische Universität Darmstadt (Institut für Sportwissenschaft), 63 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Sportunterricht und seine Legitimation sind heute wieder in aller Munde. Vor dem Hintergrund der Diskussionen nach dem schlechten deutschen PISA-Abschneiden einerseits (der Sport erscheint hier im Vergleich zu den so genannten Kernfächern als entbehrlich) und der vorherrschenden Bewegungs- und Erfahrungsarmut unseres alltäglichen Lebens andererseits wird wieder verstärkt nachgedacht über die Gründe, ob und warum Sport in der Schule überhaupt unterrichtet und auf welche Weise das getan werden sollte. Diese Diskussion ist nun kein wirklich neues Phänomen, vielmehr zieht sie sich quer durch die Geschichte der modernen Leibeserziehung, deren Beginn in der Literatur übereinstimmend bei den Philanthropen verortet ist. Es ist ein Trugschluss in der (Sport)Pädagogik von einem stetig zunehmenden Erkenntnisgewinn hin zu immer größerer Allgemeinheit und Reichweite auszugehen. Ziele, Methoden und Inhalte wandeln sich, sie sind abhängig von der jeweiligen Zeit, von der gesellschaftlichen Lage und Stimmung. Dabei gibt es keinen ständigen Fortschritt, alt bekanntes taucht wieder auf und verschwindet in der Versenkung, nur um einige Zeit später in neuem Gewand wieder zu erscheinen. Es scheint daher lehrreich einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, weil er die Abhängigkeit und Relativität dessen, was uns heute richtig erscheint, freilegen kann (vgl. Kurz, 1993, S. 12). Vor diesem Hintergrund erscheint es interessant einmal genauer nachzuschauen, wie sich die Begründungen für Leibeserziehung/Sportunterricht (Ziele) und ebenso wichtig, die jeweilige Umsetzung in die Praxis (Inhalte/Methoden), denn ohne den Blick auf die reale Praxis bleibt der Blick auf die Ziele eine leere Hülle, im Laufe der Zeit gewandelt haben. Was bleibt, was kommt und geht und was kann uns das für heute sagen, das ist die entscheidende Frage. Aus diesem Grund ist der Fortlauf dieser Arbeit in drei große Teile gegliedert. Der erste Teil ist der Analyse des Zeitalters der Philanthropen, dem Beginn der modernen Leibeserziehung, gewidmet (Rahmenbedingungen, Ziele, Inhalte, Methoden der Leibeserziehung), während im zweiten Teil der heutige Ist-Zustand des Sportunterrichts anhand von fachdidaktischen Modellen, Lehrplänen und einem Blick in die Schulrealität beleuchtet wird. Abschließend erfolgt dann ein Vergleich der beiden Zeiten, aus dem wir interessante Folgerungen für die heutige bzw. zukünftige Begründung von Sportunterricht und deren Umsetzung in die Praxis ziehen können.
Examensarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Sport - Sportpädagogik, Didaktik, Note: 1,0, Technische Universität Darmstadt (Institut für Sportwissenschaft), 63 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Sportunterricht und seine Legitimation sind heute wieder in aller Munde. Vor dem Hintergrund der Diskussionen nach dem schlechten deutschen PISA-Abschneiden einerseits (der Sport erscheint hier im Vergleich zu den so genannten Kernfächern als entbehrlich) und der vorherrschenden Bewegungs- und Erfahrungsarmut unseres alltäglichen Lebens andererseits wird wieder verstärkt nachgedacht über die Gründe, ob und warum Sport in der Schule überhaupt unterrichtet und auf welche Weise das getan werden sollte. Diese Diskussion ist nun kein wirklich neues Phänomen, vielmehr zieht sie sich quer durch die Geschichte der modernen Leibeserziehung, deren Beginn in der Literatur übereinstimmend bei den Philanthropen verortet ist. Es ist ein Trugschluss in der (Sport)Pädagogik von einem stetig zunehmenden Erkenntnisgewinn hin zu immer größerer Allgemeinheit und Reichweite auszugehen. Ziele, Methoden und Inhalte wandeln sich, sie sind abhängig von der jeweiligen Zeit, von der gesellschaftlichen Lage und Stimmung. Dabei gibt es keinen ständigen Fortschritt, alt bekanntes taucht wieder auf und verschwindet in der Versenkung, nur um einige Zeit später in neuem Gewand wieder zu erscheinen. Es scheint daher lehrreich einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, weil er die Abhängigkeit und Relativität dessen, was uns heute richtig erscheint, freilegen kann (vgl. Kurz, 1993, S. 12). Vor diesem Hintergrund erscheint es interessant einmal genauer nachzuschauen, wie sich die Begründungen für Leibeserziehung/Sportunterricht (Ziele) und ebenso wichtig, die jeweilige Umsetzung in die Praxis (Inhalte/Methoden), denn ohne den Blick auf die reale Praxis bleibt der Blick auf die Ziele eine leere Hülle, im Laufe der Zeit gewandelt haben. Was bleibt, was kommt und geht und was kann uns das für heute sagen, das ist die entscheidende Frage. Aus diesem Grund ist der Fortlauf dieser Arbeit in drei große Teile gegliedert. Der erste Teil ist der Analyse des Zeitalters der Philanthropen, dem Beginn der modernen Leibeserziehung, gewidmet (Rahmenbedingungen, Ziele, Inhalte, Methoden der Leibeserziehung), während im zweiten Teil der heutige Ist-Zustand des Sportunterrichts anhand von fachdidaktischen Modellen, Lehrplänen und einem Blick in die Schulrealität beleuchtet wird. Abschließend erfolgt dann ein Vergleich der beiden Zeiten, aus dem wir interessante Folgerungen für die heutige bzw. zukünftige Begründung von Sportunterricht und deren Umsetzung in die Praxis ziehen können.