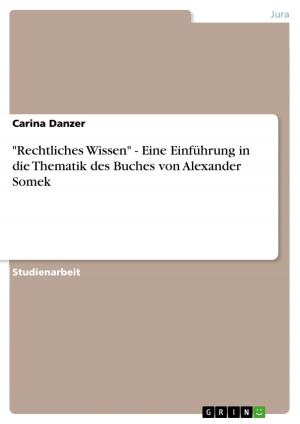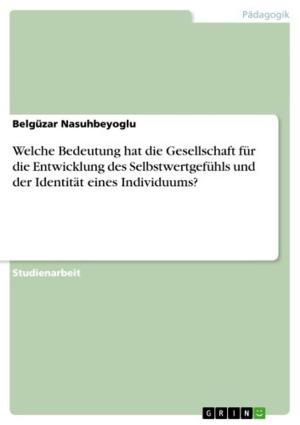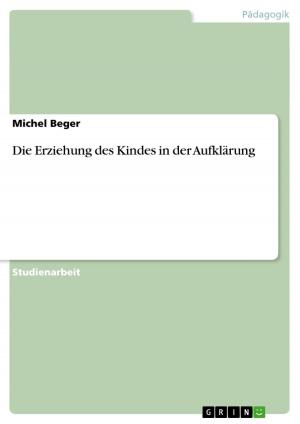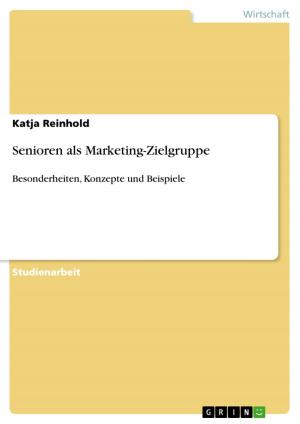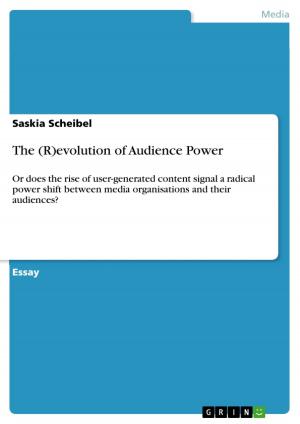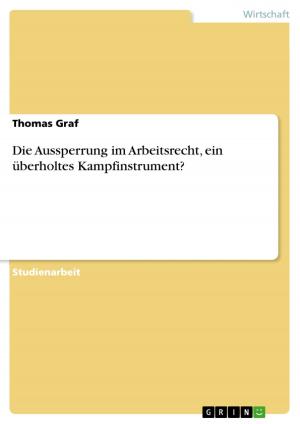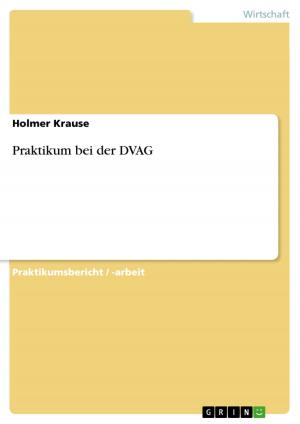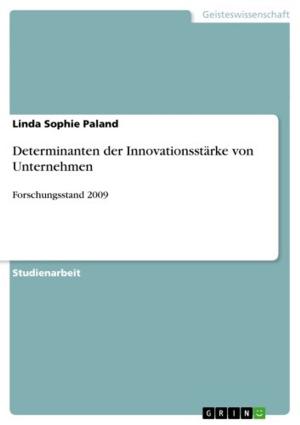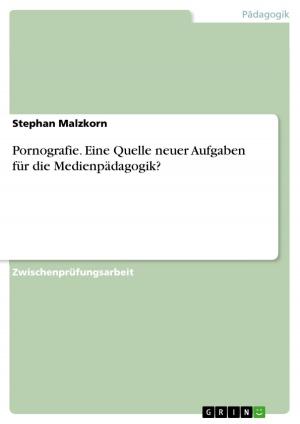That's Why Equality. Warum die Gleichheitspräsumtion keine Anmaßung ist.
Nonfiction, Social & Cultural Studies, Political Science, Politics, History & Theory| Author: | Robert Rädel | ISBN: | 9783638521703 |
| Publisher: | GRIN Verlag | Publication: | July 17, 2006 |
| Imprint: | GRIN Verlag | Language: | German |
| Author: | Robert Rädel |
| ISBN: | 9783638521703 |
| Publisher: | GRIN Verlag |
| Publication: | July 17, 2006 |
| Imprint: | GRIN Verlag |
| Language: | German |
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Politik - Politische Theorie und Ideengeschichte, Note: 1,0, Freie Universität Berlin (Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft), Veranstaltung: HS Gerechtigkeit und Gleichheit, 6 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In der politischen Gegenwartsphilosophie ist eine Debatte um Gleichheit und Gerechtigkeit im Gange. Zwei zentrale Fragen spielen dabei eine Rolle. Während auf der Seite der so genannten Egalitaristen vor allem die 'Equality-of-What' - Diskussion dominiert und gefragt wird, in welcher Hinsicht (welche Güter, Ressourcen, Freiheiten etc.) Gleichheit ausbuchstabiert werden soll, kritisieren die Non-Egalitaristen grundsätzlich, warum Gleichheit überhaupt ein besonderer Wert in der Gerechtigkeitsdiskussion zukommen soll. Stefan Gosepaths Versuch, egalitäre Gerechtigkeit zu verteidigen, mündete in der Theorie der 'Gleichheitspräsumtion'. Diese Vorrangregel für egalitäre Prinzipien wird von u.a. Thomas Schramme kritisiert. Das Anliegen dieser Arbeit ist zu zeigen, dass diese Kritik ungerechtfertigt ist, dass die Inklusionstheorie kein geeigneter Beitrag zur philosophischen Suche nach Gerechtigkeit ist. Gerechtigkeit kann nicht an absoluten, im Zweifelsfall minimalistischen Standards eines guten Lebens gemessen werden. Diese gehören zu einem anderen Teil der Moral, der Humanität. Für eine Theorie der Gerechtigkeit ist Gleichheit ein zentraler Wert. Gerechtigkeit ist immer relational zu anderen Menschen und erst durch einen Vergleich feststellbar. Sowohl das Gebot der Gleichbehandlung, als auch das der prima facie gleichen Berücksichtigung der Ansprüche aller bei der Verteilung von Gütern folgt direkt aus der moralischen Gleichwertigkeit und gleichen Achtung aller Menschen. Die Argumente von Schramme können die Logik der Gleichheitspräsumtion als prozeduralen Ausgangspunkt von Gerechtigkeitsüberlegungen nicht angreifen. Gleichheit ist nicht oberstes Ziel von Gerechtigkeit, sondern Voraussetzung. Auch die Aufteilung in absolute und komparative Vergleichsmaßstäbe oder die Umkehrung der Beweislast bei der Verteilungsregel liefern keine Alternative für die Gleichheitspräsumtion. Objektive Kriterien eines guten Lebens, welche die Angemessenheit von Behandlungen oder Güterverteilungen festlegen könnten, sind eine eine Anmaßung, und könnten höchstens in konservativ-autoritären Regimen Durchsetzung finden. Moralische Ansprüche auf einen gleichen Anteil am gesellschaftlichen Reichtum und individuelle Gerechtigkeitsempfindungen müssen nicht zu Gunsten des gesellschaftlichen Friedens aufgegeben werden. Man muss fragen dürfen, mit welchem Recht jemand seinen übermäßigen Besitz beansprucht, ein Kritikverbot an den herrschenden Verhältnissen ist moralisch unhaltbar.
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Politik - Politische Theorie und Ideengeschichte, Note: 1,0, Freie Universität Berlin (Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft), Veranstaltung: HS Gerechtigkeit und Gleichheit, 6 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In der politischen Gegenwartsphilosophie ist eine Debatte um Gleichheit und Gerechtigkeit im Gange. Zwei zentrale Fragen spielen dabei eine Rolle. Während auf der Seite der so genannten Egalitaristen vor allem die 'Equality-of-What' - Diskussion dominiert und gefragt wird, in welcher Hinsicht (welche Güter, Ressourcen, Freiheiten etc.) Gleichheit ausbuchstabiert werden soll, kritisieren die Non-Egalitaristen grundsätzlich, warum Gleichheit überhaupt ein besonderer Wert in der Gerechtigkeitsdiskussion zukommen soll. Stefan Gosepaths Versuch, egalitäre Gerechtigkeit zu verteidigen, mündete in der Theorie der 'Gleichheitspräsumtion'. Diese Vorrangregel für egalitäre Prinzipien wird von u.a. Thomas Schramme kritisiert. Das Anliegen dieser Arbeit ist zu zeigen, dass diese Kritik ungerechtfertigt ist, dass die Inklusionstheorie kein geeigneter Beitrag zur philosophischen Suche nach Gerechtigkeit ist. Gerechtigkeit kann nicht an absoluten, im Zweifelsfall minimalistischen Standards eines guten Lebens gemessen werden. Diese gehören zu einem anderen Teil der Moral, der Humanität. Für eine Theorie der Gerechtigkeit ist Gleichheit ein zentraler Wert. Gerechtigkeit ist immer relational zu anderen Menschen und erst durch einen Vergleich feststellbar. Sowohl das Gebot der Gleichbehandlung, als auch das der prima facie gleichen Berücksichtigung der Ansprüche aller bei der Verteilung von Gütern folgt direkt aus der moralischen Gleichwertigkeit und gleichen Achtung aller Menschen. Die Argumente von Schramme können die Logik der Gleichheitspräsumtion als prozeduralen Ausgangspunkt von Gerechtigkeitsüberlegungen nicht angreifen. Gleichheit ist nicht oberstes Ziel von Gerechtigkeit, sondern Voraussetzung. Auch die Aufteilung in absolute und komparative Vergleichsmaßstäbe oder die Umkehrung der Beweislast bei der Verteilungsregel liefern keine Alternative für die Gleichheitspräsumtion. Objektive Kriterien eines guten Lebens, welche die Angemessenheit von Behandlungen oder Güterverteilungen festlegen könnten, sind eine eine Anmaßung, und könnten höchstens in konservativ-autoritären Regimen Durchsetzung finden. Moralische Ansprüche auf einen gleichen Anteil am gesellschaftlichen Reichtum und individuelle Gerechtigkeitsempfindungen müssen nicht zu Gunsten des gesellschaftlichen Friedens aufgegeben werden. Man muss fragen dürfen, mit welchem Recht jemand seinen übermäßigen Besitz beansprucht, ein Kritikverbot an den herrschenden Verhältnissen ist moralisch unhaltbar.