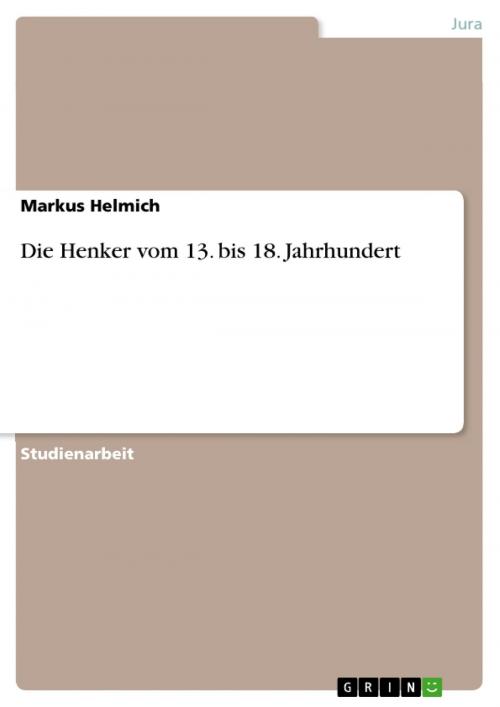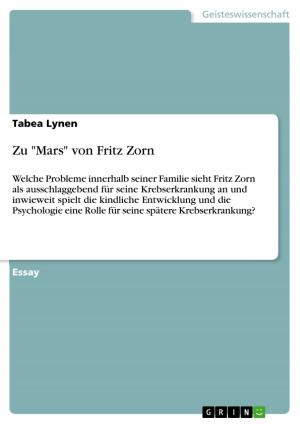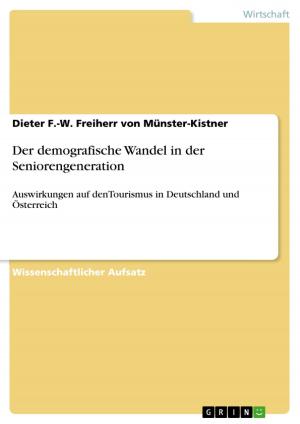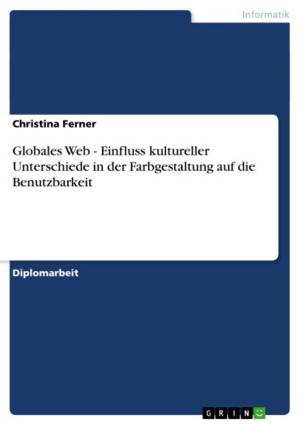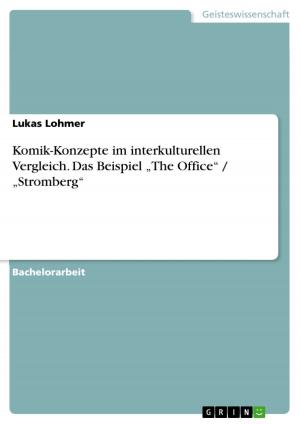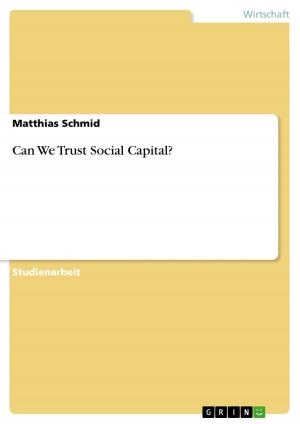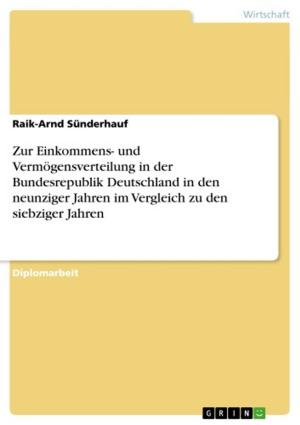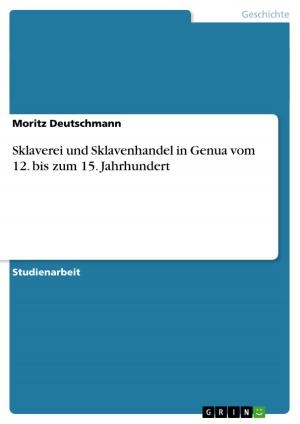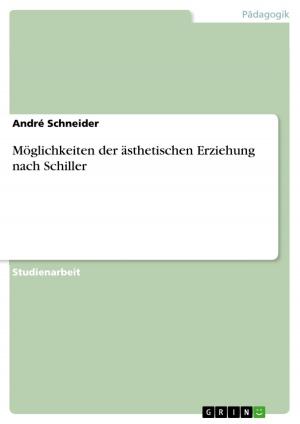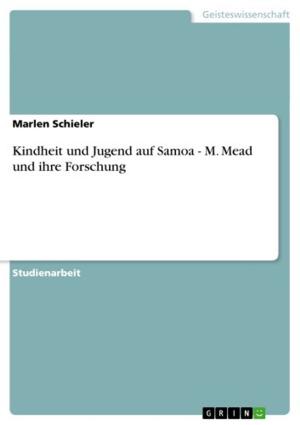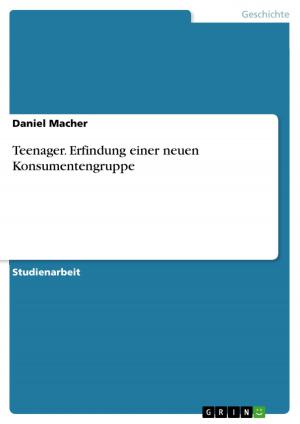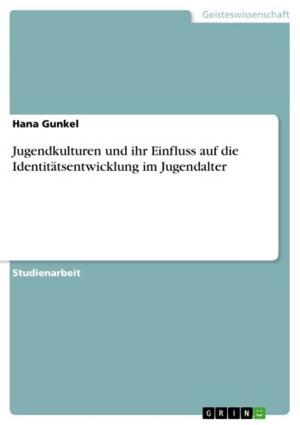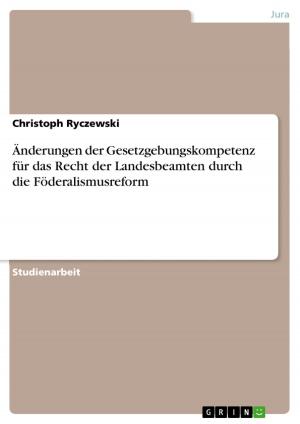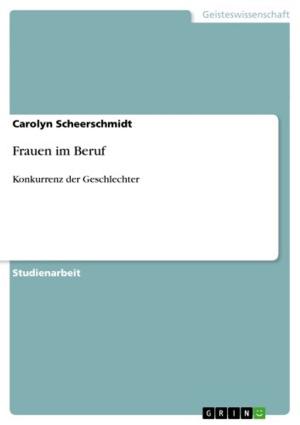| Author: | Markus Helmich | ISBN: | 9783656001799 |
| Publisher: | GRIN Verlag | Publication: | September 8, 2011 |
| Imprint: | GRIN Verlag | Language: | German |
| Author: | Markus Helmich |
| ISBN: | 9783656001799 |
| Publisher: | GRIN Verlag |
| Publication: | September 8, 2011 |
| Imprint: | GRIN Verlag |
| Language: | German |
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Jura - Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte, Note: 3, Ruhr-Universität Bochum (Rechtsgeschichte), Sprache: Deutsch, Abstract: Der Beruf des Henkers durchlief anfangs eine unruhige Zeit Es gab keinen berufsmäßigen Scharfrichter bis zum 13. Jahrhundert. Ein Anlass für das anfängliche Desinteresse am Henkerberuf war nicht nur der blutige Beruf, sondern auch dass die Todesstrafen bis zu den Landfrieden die Ausnahme darstellten. Am Ende des Spätmittelalters hatte nahezu jede größere Stadt einen eigenen Henker. Tabuisierung und Ambivalenz führten zur Zwiespältigkeit Der Henkerberuf galt als 'unrein' und 'unehrlich' und war ein 'unbeliebter' Beruf. Den Stammhaltern von Henkern stand bis Anfang des 18. Jahrhunderts kein anderer Berufsweg offen. Doch dieser Teil des 'Fluches' nahmen die Reichsgesetze der Jahre 1731 und 1772 von der Henkersfamilie, indem sie jene Kinder und Enkel für ehrlich erklärten. Zu den direkten Aufgaben des Scharfrichters gehörten die Todes- und Leibesstrafen. Art und Form der Hinrichtung orientierte sich an der Gefährlichkeit und der Schwere des Vergehens. Die Folge war, dass es mehrere Arten von Hinrichtungen gegeben haben muss: Enthauptungen, Lebendigbegraben, Pfählen, Rädern, Verbrennen und Vierteilen. Dazu kamen Körper- und Ehrenstrafen sowie die Durchführung der peinlichen Befragung oder Folter. Daneben musste er auch oft unangenehme Nebenaufgaben übernehmen: z. B. Kloakenreinigung, die Bestattung von Selbstmördern, die Aufsicht über die Prostituierten sowie beanstandete Bücher zu verbrennen. Ein eigenartiger Gegensatz bestand in der häufig vorkommenden Verbindung von Scharfrichter und Heilkundigem: Er nahm das Leben, quälte die Gesetzesbrecher, doch dem anderen half er als fachmännischer und anerkannter Arzt und Chirurge. Die Hinrichtung war vereinzelt ein Schauspiel. Die Hinrichtung sollte ein würdevoller, erhebender Akt mit erzieherischer Wirkung auf die Öffentlichkeit sein. Das blutige Schauspiel war tatsächlich geeignet, Aggressionen abzubauen und große, erregte Massen zu beruhigen und Macht zu demonstrieren. Psychologische Schäden waren nicht selten Diese Tätigkeit verursachte bei vielen Henkern schwere seelische Störungen. Alkoholsucht, Depressionen und Selbstmord waren die häufigsten Ausprägungen. Aufgrund ihrer medizinischen Fähigkeiten ließen sich zahlreiche Nachkommen der Henker seit dem 18. Jahrhundert vermehrt in ärztlichen Berufsfeldern nieder.
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Jura - Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte, Note: 3, Ruhr-Universität Bochum (Rechtsgeschichte), Sprache: Deutsch, Abstract: Der Beruf des Henkers durchlief anfangs eine unruhige Zeit Es gab keinen berufsmäßigen Scharfrichter bis zum 13. Jahrhundert. Ein Anlass für das anfängliche Desinteresse am Henkerberuf war nicht nur der blutige Beruf, sondern auch dass die Todesstrafen bis zu den Landfrieden die Ausnahme darstellten. Am Ende des Spätmittelalters hatte nahezu jede größere Stadt einen eigenen Henker. Tabuisierung und Ambivalenz führten zur Zwiespältigkeit Der Henkerberuf galt als 'unrein' und 'unehrlich' und war ein 'unbeliebter' Beruf. Den Stammhaltern von Henkern stand bis Anfang des 18. Jahrhunderts kein anderer Berufsweg offen. Doch dieser Teil des 'Fluches' nahmen die Reichsgesetze der Jahre 1731 und 1772 von der Henkersfamilie, indem sie jene Kinder und Enkel für ehrlich erklärten. Zu den direkten Aufgaben des Scharfrichters gehörten die Todes- und Leibesstrafen. Art und Form der Hinrichtung orientierte sich an der Gefährlichkeit und der Schwere des Vergehens. Die Folge war, dass es mehrere Arten von Hinrichtungen gegeben haben muss: Enthauptungen, Lebendigbegraben, Pfählen, Rädern, Verbrennen und Vierteilen. Dazu kamen Körper- und Ehrenstrafen sowie die Durchführung der peinlichen Befragung oder Folter. Daneben musste er auch oft unangenehme Nebenaufgaben übernehmen: z. B. Kloakenreinigung, die Bestattung von Selbstmördern, die Aufsicht über die Prostituierten sowie beanstandete Bücher zu verbrennen. Ein eigenartiger Gegensatz bestand in der häufig vorkommenden Verbindung von Scharfrichter und Heilkundigem: Er nahm das Leben, quälte die Gesetzesbrecher, doch dem anderen half er als fachmännischer und anerkannter Arzt und Chirurge. Die Hinrichtung war vereinzelt ein Schauspiel. Die Hinrichtung sollte ein würdevoller, erhebender Akt mit erzieherischer Wirkung auf die Öffentlichkeit sein. Das blutige Schauspiel war tatsächlich geeignet, Aggressionen abzubauen und große, erregte Massen zu beruhigen und Macht zu demonstrieren. Psychologische Schäden waren nicht selten Diese Tätigkeit verursachte bei vielen Henkern schwere seelische Störungen. Alkoholsucht, Depressionen und Selbstmord waren die häufigsten Ausprägungen. Aufgrund ihrer medizinischen Fähigkeiten ließen sich zahlreiche Nachkommen der Henker seit dem 18. Jahrhundert vermehrt in ärztlichen Berufsfeldern nieder.