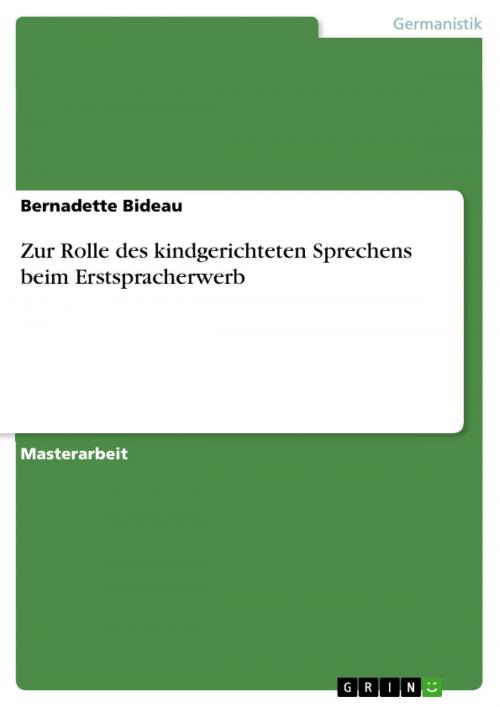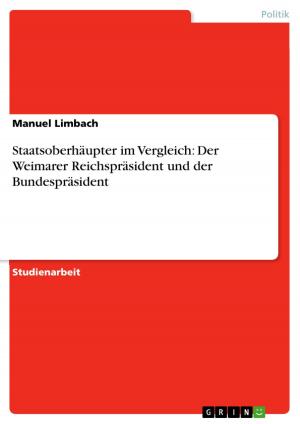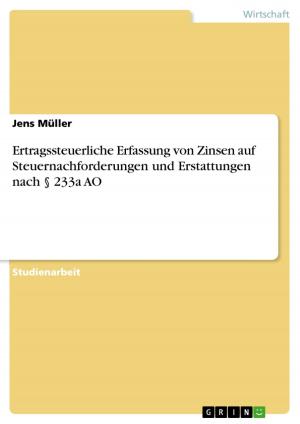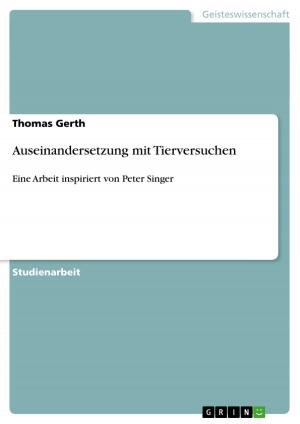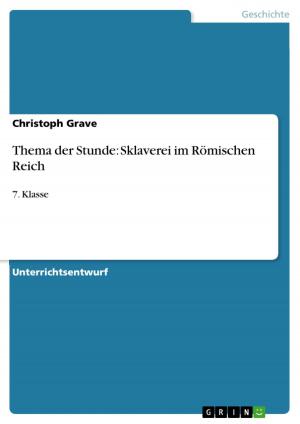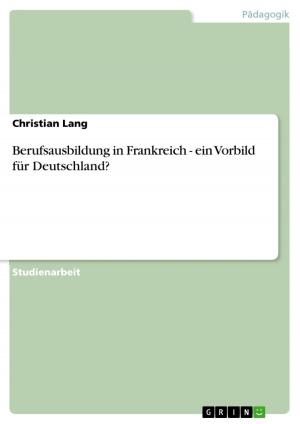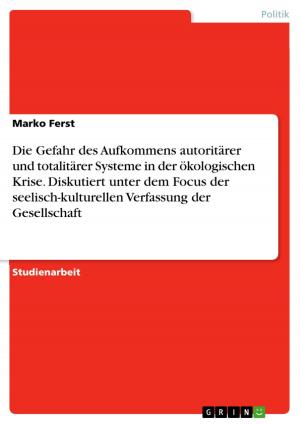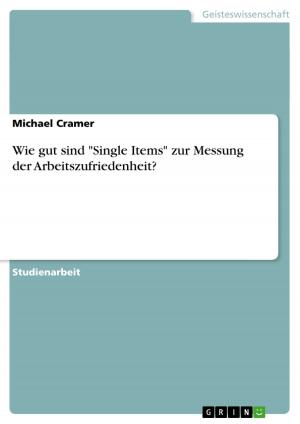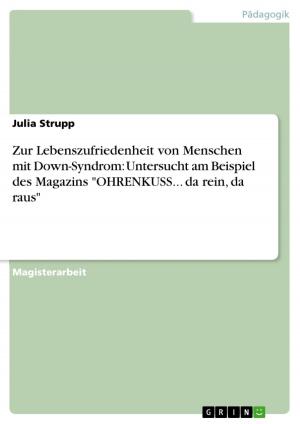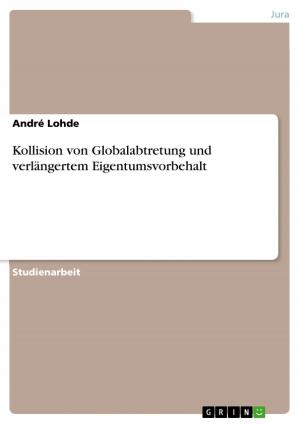Zur Rolle des kindgerichteten Sprechens beim Erstspracherwerb
Fiction & Literature, Literary Theory & Criticism, European, German| Author: | Bernadette Bideau | ISBN: | 9783638498258 |
| Publisher: | GRIN Verlag | Publication: | May 7, 2006 |
| Imprint: | GRIN Verlag | Language: | German |
| Author: | Bernadette Bideau |
| ISBN: | 9783638498258 |
| Publisher: | GRIN Verlag |
| Publication: | May 7, 2006 |
| Imprint: | GRIN Verlag |
| Language: | German |
Masterarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 1,3, Ruhr-Universität Bochum, 29 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Aufgabe des Spracherwerbs ist eine außerordentlich komplexe. Seit Beginn der Spracherwerbsforschung zum Ende des 19. Jahrhunderts (Elsen 1991:20) haben sich - vor allem in Folge von Chomskys Generativer Transformationsgrammatik - mehrere Theorien entwickelt, die sich uneinig darin sind, wie das Kind die Aufgabe des Spracherwerbs meistert, welche spezifischen Fähigkeiten es in den Spracherwerbsprozess einbringt und welche Mechanismen in diesem Prozess wirken. Zunächst muss man also herausfinden, was das Kind für den Spracherwerb selbst mitbringt. Angesichts der Komplexität und dem raschen Verlauf des Spracherwerbsprozesses (das Kind erwirbt bis zum 6. Lebensjahr Grundlagen in Phonologie, Syntax, Morphologie und Lexikon) könnte man schließen, dass das Kind, das in anderen Bereichen kognitiv noch lange nicht so weit entwickelt ist, unterstützt wird durch seine Umwelt. Besonders die Rolle der Umwelt (die Beziehung zwischen Kind und Bezugsperson, die Besonderheit der Sprache der Bezugsperson zum Kind, die Bedeutung der vorsprachlichen Kommunikation zwischen Kind und Bezugsperson) ist seit den 80/90er Jahren in das Blickfeld von Spracherwerbsforschern gerückt. Chomskys nativistische Sicht des Spracherwerbs, die der sozialen Umwelt nur eine sehr geringe bis gar keine Bedeutung für den Spracherwerb beimisst, wurde bereits Ende der 70er Jahre stark kritisiert; interaktionistische Ansätze traten in den Vordergrund, die der sozialen Umwelt und besonders den Interaktionen zwischen Kind und Umwelt eine große Bedeutung für den Spracherwerb einräumen. Dabei wird besonders die Rolle des sprachlichen Inputs diskutiert, also jenes Sprachmaterial, das ein Kind durch seine Umwelt empfängt, sowohl die Sprache, die explizit an das Kind gerichtet ist, als auch die Sprache, die die Erwachsenen untereinander sprechen. Bei der Untersuchung der Sprache, die speziell an das Kind gerichtet ist, zeigte sich, dass sie spezifische Merkmale hat, die auf das Verständnisniveau des Kindes abgestimmt sind. Diese 'einfache' Sprache soll dem Kind helfen, Sprache zu verstehen, zu lernen und zu sprechen. Umstritten ist jedoch bisher, ob diese vereinfachte Sprache für den Spracherwerb überhaupt förderlich ist. Dass sie weit verbreitet verwendet wird, impliziert nicht zwingend, dass ein Spracherwerb ohne kindgerichtete Sprache nicht möglich ist. So soll die vorliegende Arbeit in erster Linie beantworten, ob die kindgerichtete Sprache für den Spracherwerb notwendig bzw. förderlich ist.
Masterarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 1,3, Ruhr-Universität Bochum, 29 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Aufgabe des Spracherwerbs ist eine außerordentlich komplexe. Seit Beginn der Spracherwerbsforschung zum Ende des 19. Jahrhunderts (Elsen 1991:20) haben sich - vor allem in Folge von Chomskys Generativer Transformationsgrammatik - mehrere Theorien entwickelt, die sich uneinig darin sind, wie das Kind die Aufgabe des Spracherwerbs meistert, welche spezifischen Fähigkeiten es in den Spracherwerbsprozess einbringt und welche Mechanismen in diesem Prozess wirken. Zunächst muss man also herausfinden, was das Kind für den Spracherwerb selbst mitbringt. Angesichts der Komplexität und dem raschen Verlauf des Spracherwerbsprozesses (das Kind erwirbt bis zum 6. Lebensjahr Grundlagen in Phonologie, Syntax, Morphologie und Lexikon) könnte man schließen, dass das Kind, das in anderen Bereichen kognitiv noch lange nicht so weit entwickelt ist, unterstützt wird durch seine Umwelt. Besonders die Rolle der Umwelt (die Beziehung zwischen Kind und Bezugsperson, die Besonderheit der Sprache der Bezugsperson zum Kind, die Bedeutung der vorsprachlichen Kommunikation zwischen Kind und Bezugsperson) ist seit den 80/90er Jahren in das Blickfeld von Spracherwerbsforschern gerückt. Chomskys nativistische Sicht des Spracherwerbs, die der sozialen Umwelt nur eine sehr geringe bis gar keine Bedeutung für den Spracherwerb beimisst, wurde bereits Ende der 70er Jahre stark kritisiert; interaktionistische Ansätze traten in den Vordergrund, die der sozialen Umwelt und besonders den Interaktionen zwischen Kind und Umwelt eine große Bedeutung für den Spracherwerb einräumen. Dabei wird besonders die Rolle des sprachlichen Inputs diskutiert, also jenes Sprachmaterial, das ein Kind durch seine Umwelt empfängt, sowohl die Sprache, die explizit an das Kind gerichtet ist, als auch die Sprache, die die Erwachsenen untereinander sprechen. Bei der Untersuchung der Sprache, die speziell an das Kind gerichtet ist, zeigte sich, dass sie spezifische Merkmale hat, die auf das Verständnisniveau des Kindes abgestimmt sind. Diese 'einfache' Sprache soll dem Kind helfen, Sprache zu verstehen, zu lernen und zu sprechen. Umstritten ist jedoch bisher, ob diese vereinfachte Sprache für den Spracherwerb überhaupt förderlich ist. Dass sie weit verbreitet verwendet wird, impliziert nicht zwingend, dass ein Spracherwerb ohne kindgerichtete Sprache nicht möglich ist. So soll die vorliegende Arbeit in erster Linie beantworten, ob die kindgerichtete Sprache für den Spracherwerb notwendig bzw. förderlich ist.