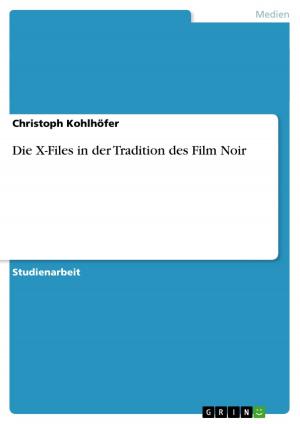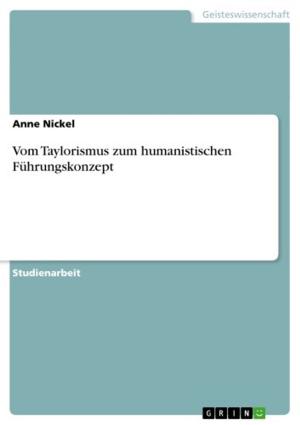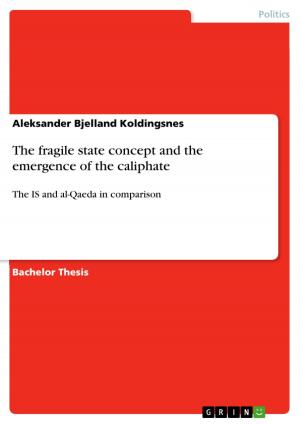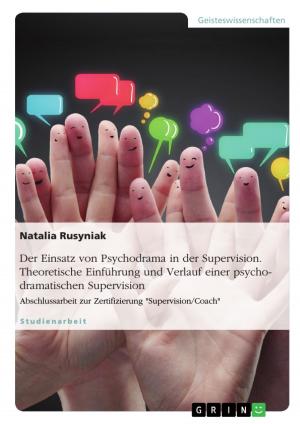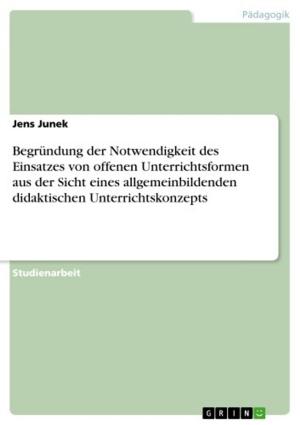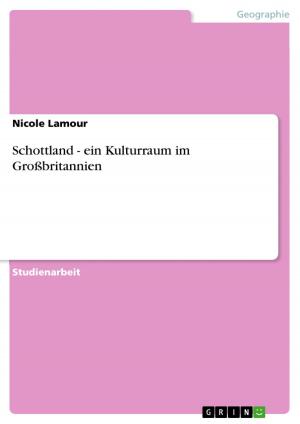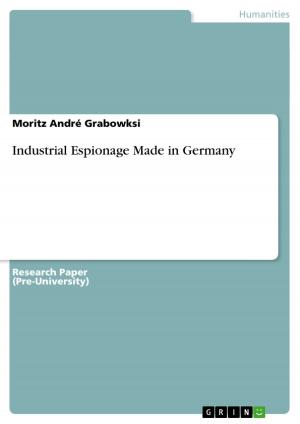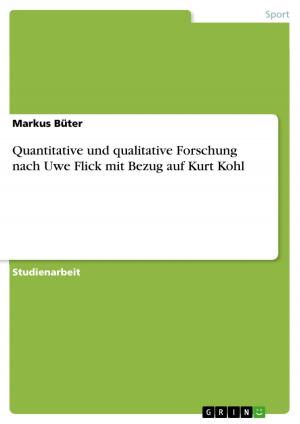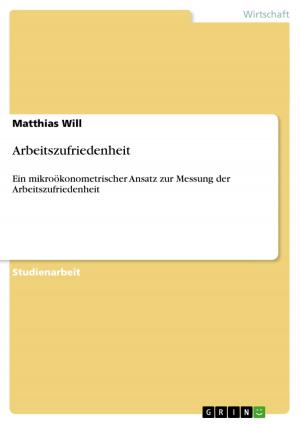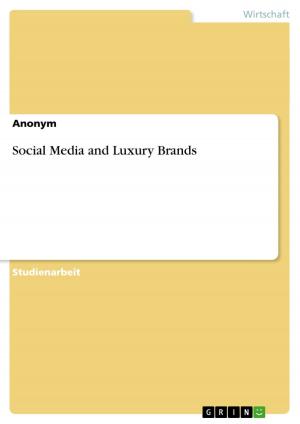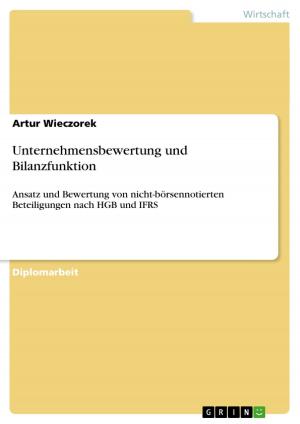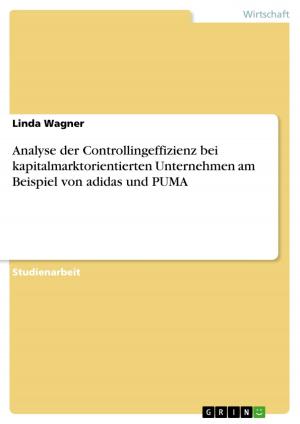Kontinuierliche Automaten und die Methode der Finiten Differenzen
Nonfiction, Science & Nature, Mathematics| Author: | Thomas Schürholz | ISBN: | 9783638365383 |
| Publisher: | GRIN Verlag | Publication: | April 13, 2005 |
| Imprint: | GRIN Verlag | Language: | German |
| Author: | Thomas Schürholz |
| ISBN: | 9783638365383 |
| Publisher: | GRIN Verlag |
| Publication: | April 13, 2005 |
| Imprint: | GRIN Verlag |
| Language: | German |
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 2,0, Universität Siegen (Simulationstechnik und Informatik im Maschinenbau), Veranstaltung: Proseminar Informatik 'Simulation mit Zellularautomaten ', 9 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Als Erstes werde ich einige Begriffe zu den Kontinuierlichen Automaten erklären und erläutern. Bisher haben wir schon einige verschiedene Arten von Zellularautomaten kennengelernt, wie z.B. den Wolfram-, den Totalistischen-, den Partikel- und den Probabilistischen Automaten. Bei all diesen Automaten war es so, dass die Zellenwerte durch bestimmte individuelle Regeln im nächsten Zeitschritt neu berechnet werden. Auffallend charakteristisch war dabei, dass alle Zellen der Automaten nur eine bestimmte Anzahl an Zuständen annehmen können. In den vorangegangenen Beispielen waren es Zustände, wie schwarz oder weiß, 0 oder 1, rot oder grün oder braun. Nun ein wenig zur Geschichte der Kontinuierlichen Automaten (im weiteren Text mit KA abgekürzt). Mitte der 1970er Jahre entstanden bzw. entwickelten sich die verschiedensten Arten von KA. Dies geschah einmal bei der Idealisierung von Differentialgleichungssystemen zur Berechnung von Wellen- oder Schwingungsgraphen, was im zweiten Teil der Ausarbeitung an einem Bespiel genauer vorgestellt wird. Außerdem entstanden damals die KA implizit beim Lösen von partiellen Differentialgleichungen durch Näherung von finiten Differenzen. Daraus entwickelte sich die Methode der finiten Differenzen, welche Hauptbestandteil der zweiten Hälfte dieses Textes ist. Erst Anfang der 1980er Jahre wurden die KA dann unter zu Hilfenahme von Computersimulationen erforscht. Dies geschah vermutlich, nachdem sich Steven Wolfram mit den gewöhnlichen Zellularautomaten eingehend beschäftigt hatte. Kommen wir nun konkret zur Art der kontinuierlichen Automaten. Das besondere beim KA im Gegensatz zu den bisher besprochenen Zellularautomaten ist, dass die Zellen Zustände aus einem unendlichen kontinuierlichen Zustandsraum annehmen können. Es können z.B. alle rationalen Zahlen zwischen 0 und 1 angenommen werden oder alle Graustufen zwischen schwarz und weiß. Dies bezeichnet man auch als den Grund für das Verlassen des klassischen Konzepts der Zellularautomaten. Die Regel des KA ist so aufgebaut, dass sich der Zustand der Zelle aus dem Durchschnittswert der Vorgängerzelle und deren beiden direkten Nachbarzellen, welche eine Gewichtung erhalten können, neu ergibt. Dort sehen wir einen KA mit der Regel, dass sich jede Zelle aus dem Durchschnittswert des Vorgängers und seiner beiden Nachbarn ergibt.
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 2,0, Universität Siegen (Simulationstechnik und Informatik im Maschinenbau), Veranstaltung: Proseminar Informatik 'Simulation mit Zellularautomaten ', 9 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Als Erstes werde ich einige Begriffe zu den Kontinuierlichen Automaten erklären und erläutern. Bisher haben wir schon einige verschiedene Arten von Zellularautomaten kennengelernt, wie z.B. den Wolfram-, den Totalistischen-, den Partikel- und den Probabilistischen Automaten. Bei all diesen Automaten war es so, dass die Zellenwerte durch bestimmte individuelle Regeln im nächsten Zeitschritt neu berechnet werden. Auffallend charakteristisch war dabei, dass alle Zellen der Automaten nur eine bestimmte Anzahl an Zuständen annehmen können. In den vorangegangenen Beispielen waren es Zustände, wie schwarz oder weiß, 0 oder 1, rot oder grün oder braun. Nun ein wenig zur Geschichte der Kontinuierlichen Automaten (im weiteren Text mit KA abgekürzt). Mitte der 1970er Jahre entstanden bzw. entwickelten sich die verschiedensten Arten von KA. Dies geschah einmal bei der Idealisierung von Differentialgleichungssystemen zur Berechnung von Wellen- oder Schwingungsgraphen, was im zweiten Teil der Ausarbeitung an einem Bespiel genauer vorgestellt wird. Außerdem entstanden damals die KA implizit beim Lösen von partiellen Differentialgleichungen durch Näherung von finiten Differenzen. Daraus entwickelte sich die Methode der finiten Differenzen, welche Hauptbestandteil der zweiten Hälfte dieses Textes ist. Erst Anfang der 1980er Jahre wurden die KA dann unter zu Hilfenahme von Computersimulationen erforscht. Dies geschah vermutlich, nachdem sich Steven Wolfram mit den gewöhnlichen Zellularautomaten eingehend beschäftigt hatte. Kommen wir nun konkret zur Art der kontinuierlichen Automaten. Das besondere beim KA im Gegensatz zu den bisher besprochenen Zellularautomaten ist, dass die Zellen Zustände aus einem unendlichen kontinuierlichen Zustandsraum annehmen können. Es können z.B. alle rationalen Zahlen zwischen 0 und 1 angenommen werden oder alle Graustufen zwischen schwarz und weiß. Dies bezeichnet man auch als den Grund für das Verlassen des klassischen Konzepts der Zellularautomaten. Die Regel des KA ist so aufgebaut, dass sich der Zustand der Zelle aus dem Durchschnittswert der Vorgängerzelle und deren beiden direkten Nachbarzellen, welche eine Gewichtung erhalten können, neu ergibt. Dort sehen wir einen KA mit der Regel, dass sich jede Zelle aus dem Durchschnittswert des Vorgängers und seiner beiden Nachbarn ergibt.