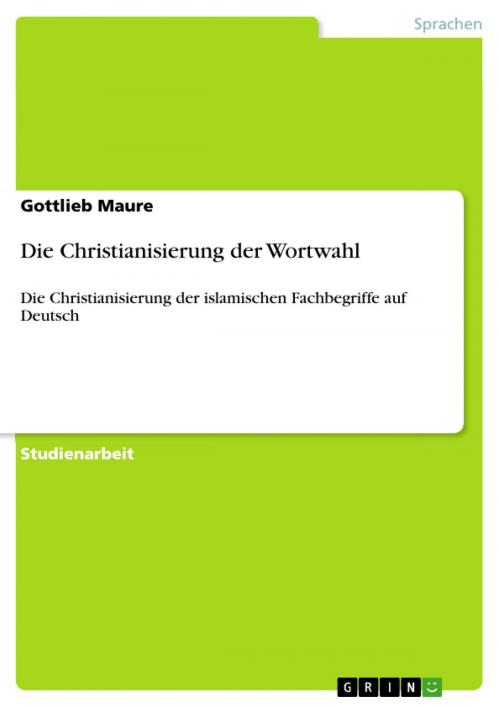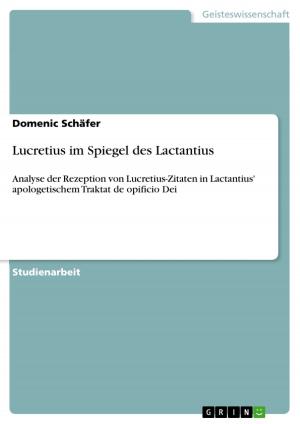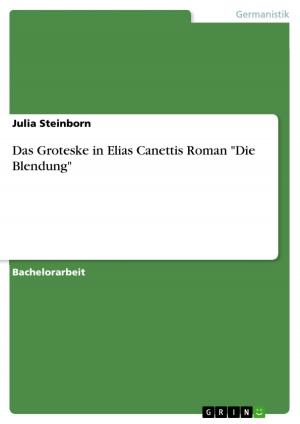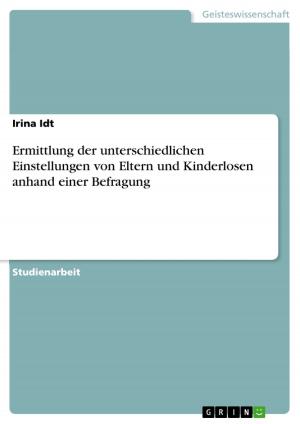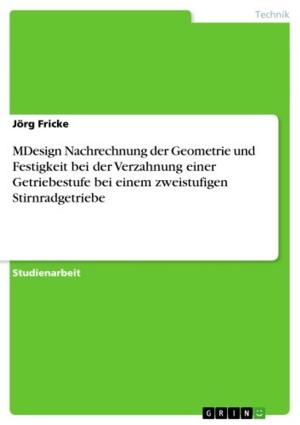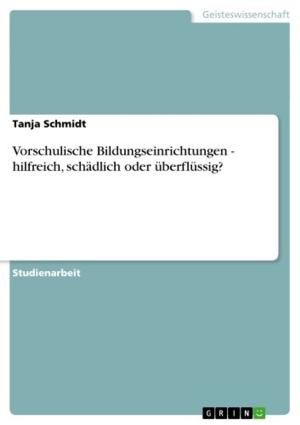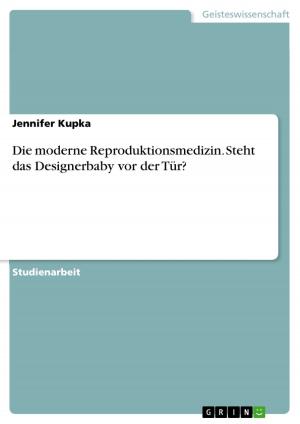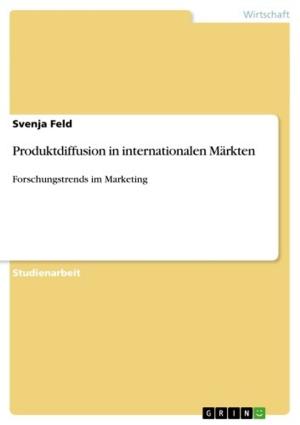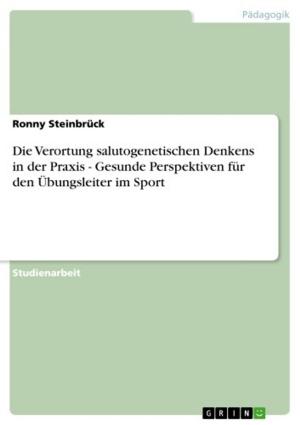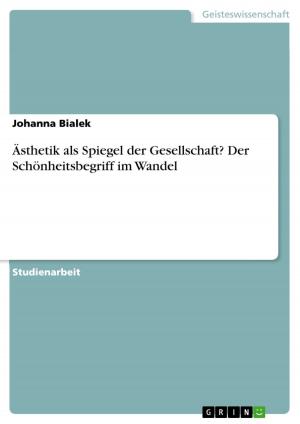Die Christianisierung der Wortwahl
Die Christianisierung der islamischen Fachbegriffe auf Deutsch
Nonfiction, Reference & Language, Foreign Languages, Arabic| Author: | Gottlieb Maure | ISBN: | 9783640265503 |
| Publisher: | GRIN Verlag | Publication: | February 11, 2009 |
| Imprint: | GRIN Verlag | Language: | German |
| Author: | Gottlieb Maure |
| ISBN: | 9783640265503 |
| Publisher: | GRIN Verlag |
| Publication: | February 11, 2009 |
| Imprint: | GRIN Verlag |
| Language: | German |
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Orientalistik / Sinologie - Arabistik, Note: 1,3, Universität Leipzig (Orientalisches Institut), Veranstaltung: Arabische Begriffe und Termini und ihr kulturhistorischer Hintergrund, 9 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Islam hat in der Welt in den letzten Jahrhunderten an Bedeutung gewonnen. Einerseits durch weltökonomische Faktoren, wie die Erdöl-Wirtschaft oder die Expansion der Märkten im Fernen und Nahen Osten, oder durch weltpolitische Faktoren, wie die zahlreichen Konflikten in der Welt, die in Gebieten stattfinden, die überwiegend von Muslimen bevölkert sind. Aber nicht nur die Globalisierung der Wirtschaft oder die Konflikte und Krisen spielen eine Rolle in der Zunahme der Wichtigkeit der Religion des Islam in der Welt. Im Westen (wenn man das Wort verwenden darf) kommt noch der Faktor der Immigration dazu. Dieses Phänomen hat zu der direkten Konfrontation bzw. Begegnung dieser Religion und ihrer Anhänger mit den westlichen Kulturen, Weltanschauungen usw. geführt. Diese Auseinandersetzung fand auf mehreren Ebenen statt. Eine davon ist die sprachliche. Die europäischen Sprachen sind in der Mehrheit säkularisierte Sprachen. Ein gleicher Begriff dient oft zur der Bezeichnung von einer von Religion zu Religion unterschiedlichen Erscheinung. Sie trägt je nach der jeweiligen Religion andere weltliche bzw. theologische Bedeutungen, sie bezieht sich auf unterschiedliche Quellen und vor allem die Erscheinung selbst ist in ihren äußerlichen sowie inneren Merkmalen anders. Die deutsche Sprache entgeht dieser Problematik nicht. Sie neigt auch zur Verwendung von Begriffen, die einerseits säkular benutzt werden, aber anderseits aus einer kirchlichen Tradition stammen. Die christlichen Begriffe, die man in der Verwendung säkularisiert hat, haben ihre Konnotationen trotzdem nicht verloren. Von daher fragt man sich, in weit diese Begriffe dem Islam, der von einer arabischen Sprachtradition herkommt, gerecht werden. Sind sie überhaupt korrekt, spiegeln sie tatsächlich den ursprünglichen Sinn der jeweiligen Erscheinungen in der islamischen Religion. Wenn nein, welche Alternativen bieten sich in der deutschen Sprache? Muss man arabische Wörter eindeutschen oder Begriffe neu schöpfen? Um dieses Thema, das eine Magisterarbeit, ja eine Doktorarbeit wert ist, zu versuchen zu problematisieren, werde ich paar Begriffe, die oft im deutschen Sprachgebrauch verwendet werden, um islamische Phänomenen zu bezeichnen, darstellen. Ich werde den deutschen sowie den arabischen (ursprünglichen) Begriff darstellen und letztlich vergleichen, inwieweit die beiden Begriffe übereinstimmen.
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Orientalistik / Sinologie - Arabistik, Note: 1,3, Universität Leipzig (Orientalisches Institut), Veranstaltung: Arabische Begriffe und Termini und ihr kulturhistorischer Hintergrund, 9 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Islam hat in der Welt in den letzten Jahrhunderten an Bedeutung gewonnen. Einerseits durch weltökonomische Faktoren, wie die Erdöl-Wirtschaft oder die Expansion der Märkten im Fernen und Nahen Osten, oder durch weltpolitische Faktoren, wie die zahlreichen Konflikten in der Welt, die in Gebieten stattfinden, die überwiegend von Muslimen bevölkert sind. Aber nicht nur die Globalisierung der Wirtschaft oder die Konflikte und Krisen spielen eine Rolle in der Zunahme der Wichtigkeit der Religion des Islam in der Welt. Im Westen (wenn man das Wort verwenden darf) kommt noch der Faktor der Immigration dazu. Dieses Phänomen hat zu der direkten Konfrontation bzw. Begegnung dieser Religion und ihrer Anhänger mit den westlichen Kulturen, Weltanschauungen usw. geführt. Diese Auseinandersetzung fand auf mehreren Ebenen statt. Eine davon ist die sprachliche. Die europäischen Sprachen sind in der Mehrheit säkularisierte Sprachen. Ein gleicher Begriff dient oft zur der Bezeichnung von einer von Religion zu Religion unterschiedlichen Erscheinung. Sie trägt je nach der jeweiligen Religion andere weltliche bzw. theologische Bedeutungen, sie bezieht sich auf unterschiedliche Quellen und vor allem die Erscheinung selbst ist in ihren äußerlichen sowie inneren Merkmalen anders. Die deutsche Sprache entgeht dieser Problematik nicht. Sie neigt auch zur Verwendung von Begriffen, die einerseits säkular benutzt werden, aber anderseits aus einer kirchlichen Tradition stammen. Die christlichen Begriffe, die man in der Verwendung säkularisiert hat, haben ihre Konnotationen trotzdem nicht verloren. Von daher fragt man sich, in weit diese Begriffe dem Islam, der von einer arabischen Sprachtradition herkommt, gerecht werden. Sind sie überhaupt korrekt, spiegeln sie tatsächlich den ursprünglichen Sinn der jeweiligen Erscheinungen in der islamischen Religion. Wenn nein, welche Alternativen bieten sich in der deutschen Sprache? Muss man arabische Wörter eindeutschen oder Begriffe neu schöpfen? Um dieses Thema, das eine Magisterarbeit, ja eine Doktorarbeit wert ist, zu versuchen zu problematisieren, werde ich paar Begriffe, die oft im deutschen Sprachgebrauch verwendet werden, um islamische Phänomenen zu bezeichnen, darstellen. Ich werde den deutschen sowie den arabischen (ursprünglichen) Begriff darstellen und letztlich vergleichen, inwieweit die beiden Begriffe übereinstimmen.